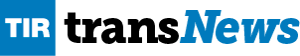Fliegende Gefahr der Drohnen entschärfen
SICHERHEIT Tausende von Drohnen gibt es in der Schweiz – Tendenz steigend. Für die Unfallforscher sind Kollisionen mit diesen unbemannten Flugobjekten vorprogrammiert. Jetzt setzt das Parlament Schranken.

Geschätzte zehn Meter hatten noch gefehlt, dann wäre es im Mai 2017 beim Anflug einer Swiss-Maschine auf Kloten zu einer Kollision mit einer Drohne gekommen. «Wie in den Vorjahren traten auch 2017 gefährliche Annäherungen zwischen bemannten und unbemannten Luftfahrzeugen auf», heisst es dazu vielsagend im aktuellen Jahresbericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust). Im Mai 2018 kam es nicht nur zu einer gefährliche Annäherung, vielmehr touchierte über dem Verzasca-Staudamm eine Drohne in einer verbotenen Zone einen Helikopter. Ein Desaster blieb aus, der Helikopter konnte unbeschadet nach Locarno zurückfliegen.
Über 100’000 Drohnen gibt es bereits in der Schweiz und jährlich werden es mehr. Damit steigt die Unfallgefahr, und zwar nicht nur im Luftraum. Saust ein unbemannter Flugkörper in die Tiefe, kann er Menschen oder auch einen Automobilisten gefährlich treffen. «Erste Unfälle mit Drohnen sind bereits passiert. Glücklicherweise blieb es bisher bei Sachschäden», sagt Bettina Zahnd, Leiterin der Abteilung Unfallforschung und Prävention beim Versicherer AXA. Mit der Verbreitung von Drohnen ist es für Zahnd nur noch eine Frage der Zeit, bis es zu schwereren Verletzungen kommt. Sie berichtet von einem Fall, bei dem eine Drohne die Autobahn als Landeplatz aussuchte. «Ein Autofahrer hatte viel Glück, dass nichts passiert war», so die Fachfrau.
Strengere Regeln für Drohnen gefordert
Weil es für Drohnen unter 30 Kilogramm heute weder für gewerbliche Einsätze noch fürs Freizeitvergnügen eine Ausbildung und kaum technische Vorschriften gibt, dürfte diese Kategorie einen Boom erleben. Deshalb plädieren die Unfallversicherer hier für verschärfte Vorschriften.
Auf EU-Ebene wurden bereits entsprechende Gesetze entworfen. Alle Piloten von Modellflugzeugen und Drohnen bis 30 Kilogramm sollen eine Online-Ausbildung absolvieren müssen. Dann erst dürfen sie an den Start.
Gemäss den Schweizer Unfallforschern sollen in Zukunft sämtliche Drohnen ab 250 Gramm registriert und gekennzeichnet werden. Denn nur so könne bei einem Zwischenfall nachverfolgt werden, wem der Flugkörper gehöre. Momentan braucht es weder Registrierung noch Vorkenntnisse, jedermann kann ein solches Gerät in den Himmel steigen lassen. Zwar haftet im Schadenfall grundsätzlich der Drohnenpilot. Aber nur, wenn er ausfindig gemacht werden kann.
Um ein Risiko möglichst zu vermeiden, fordern die Unfallforscher für alle Piloten einer Drohne ab 500 Gramm eine obligatorische Theorieprüfung. Für Fluggeräte ab 900 Gramm soll zusätzlich eine praktische Weiterbildung nötig werden.
Was passieren kann, wenn eine Drohne unsachgemäss gesteuert wird, hat der Unfallversicherer letztes Jahr bei seinem traditionellen Crashtest auf dem ehemaligen Militärflugplatz Dübendorf demonstriert: Eine neun Kilogramm schwere Transportdrohne stürzt mit einer Geschwindigkeit von über 70 km/h in das Seitenfenster eines Autos (Foto). Der Aufprall hat gezeigt, dass dabei der PW-Lenker schwere bis tödliche Verletzungen davonträgt.

Was meint der Drohnenverband?
Der Präsident des Schweizerischen Verbandes Ziviler Drohnen (SVZD), Ueli Sager, begrüsst die liberale Regelung der Schweiz im Drohnenbereich, schliesslich ziehe dies auch zahlreiche Firmen an. Er, der mit seinem Dienstleistungsunternehmen gewerbliche Drohnenflüge anbietet, unterstützt aber grundsätzlich die Forderungen der Unfallforscher. Er weist darauf hin, dass der Drohnenverband wie auch diverse Unternehmen bereits heute Kurse für angehende und fortgeschrittene Piloten anbieten würden. Aber klar, diese seien freiwillig.
Die unbemannten Flugkörper kommen immer häufiger zum Einsatz, gerade auch bei Blaulichtorganisationen. Bereits heute würden viele Polizeikorps mit den Fluggeräten arbeiten, hauptsächlich zur Dokumentation von Unfällen. Aber auch die Feuerwehr setze vermehrt auf dieses Instrument, das ihr hilfreiche Dienste biete. Seien die Drohnenpiloten der Polizei meist gut instruiert, würden in der Milizfeuerwehr meist Freiwillige mit unterschiedlichem Kenntnisstand eingesetzt, weiss Ueli Saxer zu berichten.
Registrierungspflicht für Drohnen kommt definitiv
Eine Forderung der Unfallversicherer hat inzwischen das Parlament in der letzten Herbstsession erfüllt. CVP-Nationalrat Martin Candinas hatte im März 2018 in einer Motion gefordert, im Bereich der Drohnen die nötigen Grundlagen für die Sicherheit der Luftfahrt und einen geordneten Betrieb zu schaffen. Seine Begründung: «Bei unkontrolliertem Betrieb steigt die Gefahr von Kollisionen mit anderen Luftfahrzeugen, insbesondere Helikoptern.» Risiken entstünden aber auch für Menschen und Anlagen wie beispielsweise kritische Infrastrukturen. Für ihn ist aber unbestritten, dass der kontrollierte Drohneneinsatz, beispielsweise im Gesundheitswesen oder bei Rettungseinsätzen, durchaus sinnvoll ist.
Sowohl der Nationalrat als auch der Ständerat haben der Motion zugestimmt. Im Klartext heisst das für die Schweiz, dass unbemannte Flugobjekte registriert werden müssen. Somit kann der Besitzer bei einem Crash identifiziert werden. Damit würden die Piloten verantwortunsvoller mit ihren Drohnen umgehen, betonte Martin Candinas in einem Interview gegenüber dem Schweizer Fernsehen.
Der Ball liegt jetzt wieder beim Bundesrat, der eine entsprechende Gesetzesvorlage ausarbeiten muss, damit Aufsicht und Kontrolle am Schweizer Drohnenhimmel klar geregelt werden.
Digitalisiertes Luftraummanagement
An der Sicherheit des Drohnenbetriebs arbeitet auch die Flugsicherung Skyguide. Sie hat ein voll digitalisiertes Luftraummanagement (U-Space) entwickelt, das bereits vor einem Jahr in Genf erfolgreich getestet wurde. Gemäss Alex Bristol, CEO von Skyguide, wird das System genutzt, um den bemannten und unbemannten Verkehr für Dutzende Drohneneinsätze in der Schweiz live abzubilden. Wie die «Unmanned Traffic Management (UTM)»-Initiative in den USA solle der U-Space als Gemeinschaftsprojekt das Situationsbewusstsein, den Datenaustausch und die digitale Kommunikation für das europäische Drohnen-Ökosystem ermöglichen.
Und so könnte die Situation am Schweizer Himmel für bestimmte Drohnen in Zukunft aussehen: Wer seinen unbemannten Flugkörper steigen lässt, muss sich im Vorfeld über eine App anmelden. Beansprucht beispielsweise ein Helikopter die Flugbahn, auf der sich gerade eine Drohne befindet, soll diese automatisch umgeleitet werden können.
Drohnenverbandspräsident Sager plädert dafür, dass ausschliesslich grosse Drohnen ihre Flüge anmelden müssen, bevor sie starten dürfen. Und er hofft, dass kleine und leichte Drohnen nicht mit administrativen Hürden belastet werden, denn von ihnen gehe keine grosse Unfallgefahr aus, so der SVZD-Präsident.
Ab wann Drohnenversicherung?
Drohnen werden in der Schweiz grundsätzlich in drei Kategorien eingeteilt und entsprechend sieht auch die Versicherungspflicht aus:
- Unbemannte Flugkörper unter 0,5 kg sind nicht bewilligungspflichtig; sie benötigen keine Drohnen-Haftpflichtversicherung. Allfällige Schäden an Dritten übernimmt die Privathaftpflicht des Drohnenpiloten, so er denn eine solche hat.
- Drohnen zwischen 0,5 kg und 30 kg sind ebenfalls nicht bewilligungspflichtig. Das gilt aber nur, wenn sie auf Sicht geflogen werden. Allerdings braucht es bei solchen Drohnen eine spezielle Haftpflichtversicherung.
- Unbemannte Flugobjekte, die nicht auf Sicht geflogen werden, und Drohnen ab einem Gewicht von mehr als 30 kg benötigen eine Bewilligung des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Bazl). Solche Drohnen werden im Rahmen der Luftfahrtassekuranz versichert.