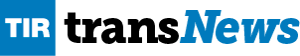Neue Antriebslösungen bringen neue Player hervor
ALTERNATIVE ANTRIEBE An neuen Antriebslösungen arbeiten nicht nur die OEMs wie DAF. Auch Technologiefirmen wie FPT und Zulieferer wie Meritor stellen sich auf die sich ändernden Anforderungen und Bedürfnisse ein. Nachfolgend eine punktuelle Auswahl von unter anderem den drei erwähnten Marken, aber auch von potenziellen neuen Playern.

Manchmal vergisst man ob der vielen Diskussionen in der Klimadebatte, welches die realistischen Ziele bei der Erneuerung von Nutzfahrzeugen sind. Denn anders als beim PW, ist das Geschäft der Nutzfahrzeuge kein Freizeitvergnügen, vielmehr müssen alle Protagonisten rund um die Transportbranche ihren Broterwerb damit bestreiten. Entsprechend ist die Einschätzung von Daimler nicht sonderlich überraschend, dass es bis 2039 dauern wird, bis alle neuen LKW im Fahrbetrieb (Tank-to-Wheel) CO2-neutral sein werden. «Diese Zahl ergibt sich aus der Zeitrechnung der Modellerneuerung», erklärt Christoph Behrendt, Leiter Strategie bei Daimler Trucks. Erste Serienelektrofahrzeuge sollen ab 2022 in allen Kernregionen im Angebot sein.
DAF fährt mehrgleisig Der unter dem Paccar-Dach stehende niederländische Lastwagenhersteller DAF hat soeben entschieden, seinen CF Electric in vorerst kleiner Stückzahl seinen Kunden in Serie anzubieten. Mit den ersten sechs seit einem Jahr im Feldtest bewegten CF Electric wurden bereits über 150’000 Kilometer zurückgelegt. «Wir haben wichtige Erkenntnisse gewonnen, die uns nun zum Serienanlauf gebracht haben», erklärt Raoul Wijnands, Chef des Testdepartments bei DAF in Eindhoven. Dabei waren nicht etwa bei den Trucks, die mit einer von VDL gelieferten Antriebstechnik bestückt sind, die grössten Veränderungen feststellbar, sondern die Chauffeure und Disponenten mussten sich umgewöhnen. «Nach wenigen Wochen wurde das Potenzial der Lastwagen mit ihrer Reichweite (bis 100 km) besser ausgenutzt», erläutert Wijnands. Auch Eveline Manders, Co-Direktorin bei Tinie Manders Transport, bestätigt: «Die Einsatzplanung und das Fahren eines Elektro-LKW verlangt ein geändertes Denken. Du musst dafür sorgen, dass die geplante Route zum Lastwagen passt, nicht umgekehrt.»

Inzwischen hat DAF den CF Electric weiterentwickelt und das Fahrzeug der «Phase 2» mit einer neuen Software sowie einem geänderten Armaturenbrett versehen. Diese Fahrzeuge werden vorerst in Holland, Belgien und im angrenzenden Nordrhein-Westfalen in kleinen Serien von jährlich ein paar wenigen Dutzend Fahrzeugen zum Kauf angeboten. «Abhängig von der Ladeinfrastruktur und den Servicemöglichkeiten werden wir auch andere Regionen in Europa in Betracht ziehen», sagt Richard Zink, DAF-Vorstand für Marketing und Verkauf.
Neben dem CF Electric erpobt auch DAF weitere Lösungen wie Hybrid und alternative Treibstoffe. Beim Hybrid haben Versuche mit Voll- und Mildhybriden eine klare Favorisierung des Vollhybrids ergeben. «Der Mildhybrid (System EcoChamps) ist zu schwach für die meisten Einsätze», zieht Raoul Wijnands Bilanz, «und er ist für den gebotenen Nutzen klar zu teuer.» Hingegen ist der Vollhybrid, der dank entsprechend dimensionierter Batterie (85 kWh) bis zu 50 Kilometer elektrisch fahren kann, in den Augen Wijnands eine ideale Lösung für Einsätze mit Stadt- und Landabschnitten. Doch die Funktionsabstimmung zwischen 330-kW-Diesel- und 130-kW-Elektromotor erweist sich als sehr aufwendig. Wijnands: «Wir werden damit erst etwa 2024 in Serie gehen können.»
Bezüglich des Einsatzes von Wasserstoff und Brennstoffzelle hat der ebenfalls zu Paccar gehördende US-Hersteller Kenworth im Hafen von Los Angeles im Frühling 2019 einen mit Toyota zusammen entwickelten Wasserstoff-Truck in Betrieb genommen. «Wenn sich die Erwartungen zur Technik erfüllen, wird die Technik auch bei uns bald zum Einsatz gelangen», so Wijnands.

Neuer Player Nr. 1 – Hyundai Wir haben in TIR transNews bereits ausführlich über die Wasserstoffinitiative der Joint Ventures Hyundai Hydrogen Mobility und Hydrospider sowie vom Nutzerförderverein H2 Mobilität Schweiz berichtet. Die Realisierung eines Wasserstoffökosystems dreht sich dabei klar um einen Lastwagen, den Hyundai mit dem Xcient Fuelcell liefert und bis 2025 in einer Zahl von 1600 Stück in die Schweiz bringen will. Hyundai sieht die in Europa zuletzt vernachlässigte Technologie als Türöffner in den europäischen Lastwagenmarkt.
Die Koreaner hatten sich 1997 für den Wasserstoffweg entschieden und haben ihn seither konsequent beschritten. Das erste Serienauto kam 2013 heraus, die zweite Generation der Technologie ist seit 2018 auf dem Markt. Einen ersten Brennstoffzellenbus hatte Hyundai bereits während der Fussball-WM in Deutschland 2006 eingesetzt. Bei den Lastwagen nutzen die Koreaner für den Xcient Fuelcell nun die zweite Generation der PW-Brennstoffzelle, indem zwei Stacks aus dem Hyundai Nexo zusammengeschaltet werden. So generieren sie eine gemeinsame Leistung von 190 kW. Der Elektromotor, der via Automatikgetriebe die Achse antreibt, leistet hingegen 350 kW (476 PS). Anders als beispielsweise Nikola (vgl. Seite 24), speichert Hyundai im Xcient Fuelcell den Wasserstoff in Tanks mit 350 bar, weil vorerst nur für 350 bar ein Protokoll für die Schnellbetankung besteht. In sieben Drucktanks zwischen Ladebrücke und Kabine können 34,5 kg Wasserstoff mitgeführt werden, was dem 34-Tönner eine Reichweite von 350 bis 400 km ermöglicht.

Veränderungen beim Bremssystem Der US-amerikanische Zulieferer Meritor hat sich mit unterschiedlichen Antriebsachsen aufs Elektrozeitalter eingestellt. So bietet die Firma aus Michigan Systeme für die drei wichtigsten Fahrzeugklassen, vom Lieferwagen bis zum 40-Tonnen-Sattelschlepper. Auch die zu den Antrieben passende Einzelradaufhängung gehört zum Sortiment von Meritor. Bei den meisten Diskussionen um den Elektroantrieb wird dem Faktor Bremsen kaum Beachtung geschenkt. Im Rahmen seiner Entwicklungen hat Meritor aber eine nachhaltige Veränderung festgestellt, die darauf zurückgeht, dass mit dem Elektroantrieb die Verzögerung zu 90 Prozent via Rekuperation bewerkstelligt wird, nur noch etwa zehn Prozent ist herkömmliches Bremsen mittels Betriebsbremse.
Gemäss Chefingenieur Paul Thomas verringern sich die thermischen Belastungen und die Abnützung der Bremsen. Dadurch lassen sich verschiedene Faktoren verändern, was schliesslich zu einer Verringerung der Einbaumasse führt. Die geringere thermische Belastung lässt eine Reduktion der Bremsscheibengrösse und -dicke zu. Und wegen der viel kleineren Anzahl an Kontaktbremsungen können die Beläge auf den Bremsbacken und -scheiben reduziert werden. Dass beim Elektroantrieb ein verringerter Bremsabrieb entsteht, ist ein weiterer Punkt, der mit einem geringeren Eigengewicht der Bremsanlage einhergeht.

FPT nicht nur im Verbrenner stark FPT wird im Normfall mit Verbrennungsmotoren in Verbindung gebracht. Die Entwickler haben neben leistungsfähigen Dieselmotoren unter anderem für Iveco auch die Erdgasmotoren auf Leistung gebracht und damit dem LNG-Antrieb zum Durchbruch verholfen. «Wir halten aber an unserem Multipower-Approach fest», sagt Giancarlo Dellora vom Produktengineering für Innovationsantriebe. Dabei spielt der effiziente Verbrennungsmotor weiter eine wichtige Rolle, denn er ist beim Erdgasmotor, beim Diesel und bei alternativen Treibstoffen wie HVO von zentraler Bedeutung.
Bereits lange vor der strategischen Partnerschaft von Iveco mit Nikola hat FPT an der Brennstoffzelle gearbeitet. Ende 2018 stand dazu beispielsweise ein Brennstoffzellenfahrgestell auf der IAA in Hannover, welches diese Entwicklung thematisierte. Zusammen mit Nikola soll das Thema aber forciert werden und später auch in die sogenannten Off-Highway-Applikationen wie Agrartraktoren einfliessen. Daneben entwickelt FPT unterschiedliche Hybridversionen, etweder in Form von Elektroachsen oder von herkömmlichen, aber durch Elektromotoren angetriebenen Achsen mit einem Kraftfluss via Differenzial. Vollelektrische Anwendungen sieht auch FPT vor allem im Kurz- und Mittelstreckenbereich sowie in leichten bis mittelschweren Anwendungen. Hybride Antriebsassistenten sowie Wasserstoff werden von FPT auf Langstreckenrouten und für schwere Gewichtsklassen favorisiert.

Neuer Player Nr. 2 – BYD Der chinesische Konzern BYD (Build Your Dream – Bau dir deinen Traum) wurde vor 25 Jahren gegründet und steht heute fest verankert im PW- und Nutzfahrzeugsektor da. Den Sprung nach Europa hat BYD mit Personenwagen bereits versucht, allerdings mit geringem Erfolg. Nun erhoffen sich die Chinesen mit Elektronutzfahrzeugen mehr Erfolg in Europa. Wie im November 2019 angekündigt, sollen noch in diesem Jahr elektrische Lieferwagen, Lastwagen und Zugmaschinen für Terminal-Anwendungen bei uns angeboten werden.
Der 4460 mm lange Kastenwagen hat eine Nutzlast von 920 kg und 3,5 m3 Laderaum. Batterie (50,3 kWh) und Elektromotor (100 kW, 180 Nm) sorgen für eine Reichweite von bis zu 360 km (NEFZ). Die Ladezeit am 40-kW-Schnelllader dauert 90 Minuten, mit Wechselstrom sind es knapp acht Stunden. Der eTruck wird als 19-Tönner geführt, der sich für Einsätze wie Abfallsammlung oder Zulieferung anbietet. Der Elektromotor leistet 180 kW und hat 1500 Nm Drehmoment. Die BYD-eigene Eisen-Phosphate-Batterie (217 kWh) bietet rund 200 km Reichweite. Die gleiche Antriebseinheit (Motor und Batterie) setzt BYD in der Terminal-Zugmaschine ein. Sie ermöglicht bei Zuggewichten von bis zu 36 Tonnen eine Einsatzdauer von bis zu zehn Stunden mit einer Ladung.

Zuerst bringt BYD den Lieferwagen und die Terminal-Zugmaschine nach Europa, die Lancierung des eTrucks wurde auf September (IAA Hannover) festgelegt. Im Laufe des Jahres soll zudem ein weiterer Lastwagen im 7,5-Tonnen-Bereich vorgestellt und dann ebenfalls nach Europa gebracht werden. BYD ist mit seinen Elektrofahrzeugen in verschiedenen Regionen rund um den Globus erfolgreich vertreten. «Wir erleben ein beispielloses Wachstum bei den Elektro-Trucks überall auf der Welt», sagt Isbrand Ho, Managing Director BYD Europe. «Es erscheint uns daher als ein natürlicher Schritt, unsere Fahrzeuge und unser Know-how auch in den europäischen Lastwagenmarkt zu bringen.»