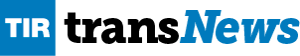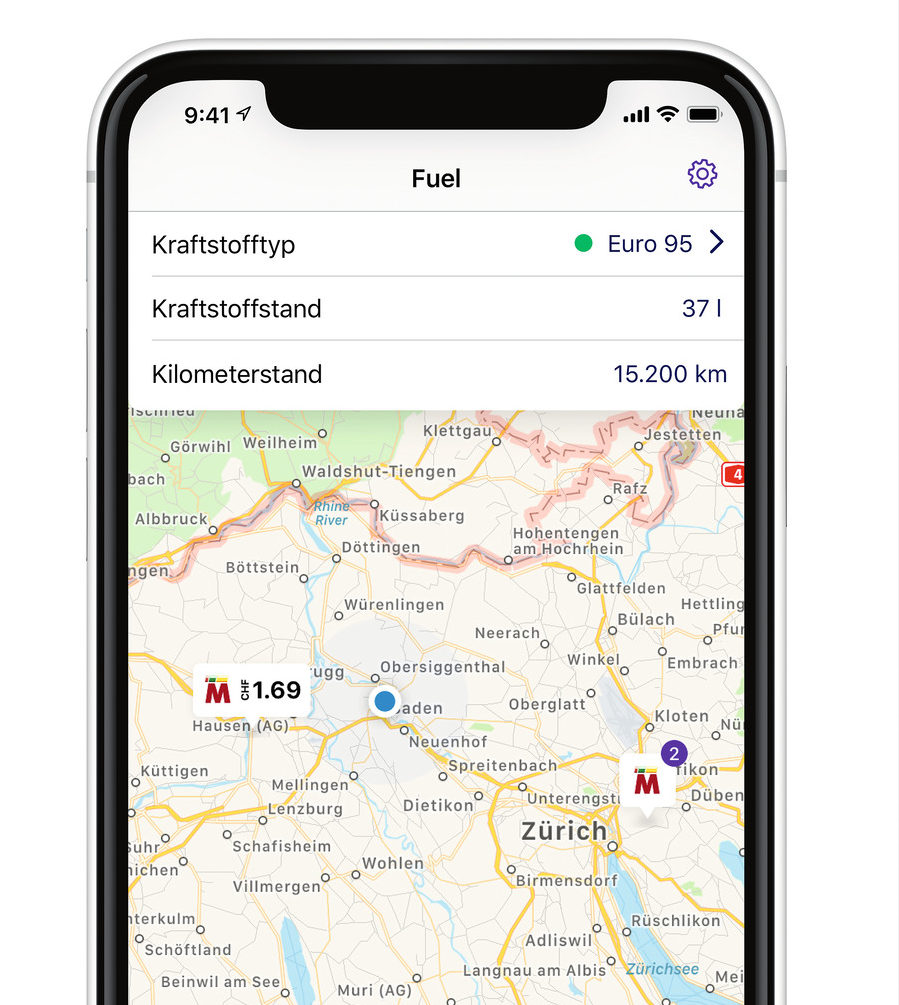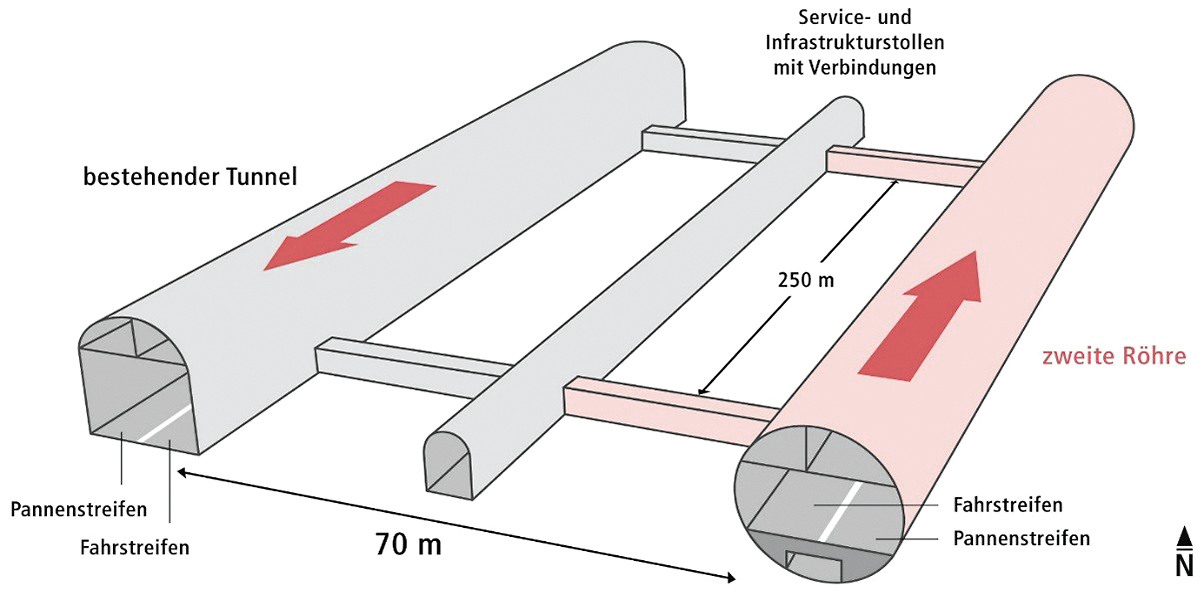Nikola und Iveco: US-italienische Freundschaft
IVECO UND NIKOLA MOTOR Der traditionsreiche Lastwagenhersteller Iveco und das amerikanische Start-up Nikola Motor spannen zusammen, um gemeinsam den Weg alternativer Antriebe zu beschreiten. Nach ersten batterieelektrischen Lastwagen sollen später Brennstoffzellen-Trucks mit der dazu nötigen Infrastruktur folgen.

Iveco kann mit Fug und Recht als Wegbereiter in Sachen Flüssigerdgas (LNG) in Europa bezeichnet werden. Getrieben von den sich abzeichnenden Klimaproblemen, haben die unmittelbaren Erdgas-Vorteile die Stosssrichtung der Italiener geprägt. Es sind dies gegenüber Diesel die Reduktion des CO2-Ausstosses um 10 bis 20 Prozent und zugleich die zum Teil fast gänzliche Eliminierung von Partikeln und NOX. Das haben inzwischen ebenfalls andere Hersteller erkannt und auch Volvo Trucks und Scania sind heute mit LNG-Modellen im Markt präsent. Trotz dieses innovativen Ansatzes ist man sich bei Iveco einig, dass ohne Elektrifizierung künftige CO2-Ziele nicht erreicht werden können. Das ist der Grund, weshalb man sich Anfang September 2019 zur strategischen Zusammenarbeit mit dem US-Start-up Nikola Motor entschieden hat und im Konzern heute acht Prozent Anteile an Nikola Motor hält. Anfang Dezember 2019 luden Iveco und Nikola nach Turin, um die noch junge Zusammenarbeit näher zu erläutern.
Jeder Marke ihre Technologie
Die Partnerschaft umfasst substanzielle Investitionen bei Nikola, indem Ivecos Mutterkonzern CNH Industrial 100 Mio. US$ in die in Phoenix, Arizona, beheimatete Firma eingeschossen hat und weitere 150 Mio. US$ in Entwicklung, Fabrikationsaufbau und Komponentenlieferung investieren wird. Ziel ist die Entwicklung und die Herstellung von elektrischen Lastwagen, die entweder mit Batterietechnik oder mit Strom aus der Brennstoffzelle angetrieben werden sollen. Dazu kommt der weltweite Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur. Die ganze Technik wird in einem zweiten Schritt bei CNHI auch in den sogenannten Off-Highway-Bereich (Baumaschinen, Traktoren usw.) einfliessen.
«Wasserstoff ist die unkomplizierteste Energie und die einzige Art, wie erneuerbare Energien gelagert werden können», begründet Gerritt Marx, verantwortlich für Nutz- und Spezialfahrzeuge bei CNHI, die Fokussierung auf Wasserstoff. Und Hubertus Mühlhäuser, CEO von CNH Industrial, doppelt nach: «Die Brennstoffzelle und das Wasserstoffökosystem werden die grösste Veränderung sein, welche die Transportindustrie in den letzten Jahrzehnten gesehen hat.» Für uns Schweizer klingt das zukunftsorientierte Projekt, das erste Wasserstoff-LKW frühestens im Jahr 2022 sehen soll, sehr bekannt. Doch die angesprochene Wasserstoffkreislaufwirtschaft ist hierzulande kein Reissbrettprojekt, sondern geht in wenigen Wochen in den Alltagsbetrieb, vorangetrieben vom Start-up H2 Energy und Hyundai Hydrogen Mobility sowie von den diversen Schweizer Partnern im Transportwesen und im Tankstellenbetrieb.

Die Kooperation von Iveco und Nikola sieht eine klare Markenteilung der Projekte vor. «Es wird keinen elektrischen Iveco geben, diese Technologie wird stets in einem Nikola anrollen», sagt Gerritt Marx. «Iveco wird sich auch künftig auf Verbrennungsmotoren und Erdgas konzentrieren.» Da es sich jedoch um ein 50:50-Joint-Venture handelt, werden die Nikola-CO2-Vorteile vollumfänglich in der CO2-Bilanz von Iveco zum Tragen kommen. Aber auch sonst wird Iveco massgeblich an jedem Nikola-Lastwagen beteiligt sein, da die Amerikaner kaum Know-how in der anspruchsvollen Entwicklung und Herstellung von LKW-Fahrgestellen und -Kabinen besitzen. Durch diese Synergie hoffen Iveco und Nikola Entwicklungskosten und Entwicklungszeiten für ihre alternativ angetriebenen Lastwagen zu reduzieren.
Batterie oder Brennstoffzelle?
Mit der Enthüllung des Sattelschleppers Nicola Tre wurde in Turin zudem ein Ausblick auf das kommende Design der Nikola-Modelle gegeben und erste technische Details zu den Antriebskonzepten wurden veröffentlicht. Die Sattelzugmaschine basiert auf dem neuen Iveco S-Way und erhält neben optischen Retuschen ein elektrisches Antriebssystem verpasst. Gemäss Mark Russel, President Nikola Corporation, wird das Serienprodukt des Nikola Tre auf der IAA Hannover diesen Herbst vorgestellt. Es wird vorerst ausschliesslich als batterieelektrische Lösung (BEV) gebaut, der Tre als Wasserstoff-FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) soll gemäss Russel im Jahr 2022 gezeigt werden können. «Wir werden künftig BEV und FCEV parallel anbieten, denn nicht jedes Transportproblem verlangt nach der gleichen technischen Lösung», betont Russel.
Die neue Technologie lässt sich nicht einfach so unterbringen. «Am schwierigsten ist die Integration der Technik wegen des eingeschränkten Platzes in Zugmaschinen», erklärt Gerritt Marx. «Deshalb konzentrieren wir uns auf den Sattelschlepper, denn wenn wir den beherrschen, ist die Thematik im Fahrgestell keine Hexerei mehr.»

Die 800-Volt-Batterien im BEV haben pro Pack eine Kapazität von 80 kWh. Das Ganze ist skalierbar und es können bis maximal neun Batteriepacks kombiniert werden. Die sich daraus ergebende Reichweite beträgt rund 400 km. Für BEV und FCEV gelangt die gleiche Elektroantriebsachse zum Einsatz, welche pro Rad einen Elektromotor besitzt. Die Achse leistet 480 kW (653 PS) und hat ein sattes Drehmoment von 1800 Nm zu bieten. Das reicht für die meisten Transporteinsätze völlig aus. Die Antriebsachse stammt aus dem Baukasten von Zulieferer Bosch, der ebenfalls in dreistelliger Millionenhöhe US$ in Nikola investiert hat. Auch die Brennstoffzelle entwickelt Nikola zusammen mit Bosch.
Der für die Brennstoffzelle nötige Wasserstoff soll in Tanks mit bis zu 80 kg Kapazität mitgeführt werden. Damit verdoppelt sich die Reichweite im Vergleich zum BEV auf 800 km. Allerdings setzt Nikola beim Speicherdruck auf 700 bar, für die es heute noch keine Schnellbetankung gibt. In einem Konsortium, in dem auch Hyundai und Toyota sitzen, aber auch Nel, Shell und Air Liquide, wird an einem neuen Protokoll für eine Schnellbetankung mit 700 bar gearbeitet. Bis es so weit ist, kann noch eine längere Zeit vergehen, was Hyundai und H2 Energy dazu bewogen hatte, im Schweizer Projekt für die Lastwagen vorerst auf 350 bar zu setzen, wofür das nötige Tankprotokoll bereits besteht.
Bezüglich Infrastruktur hat Nikola klare Vorstellungen. In den USA soll bis 2028 ein Netz von über 700 Wasserstofftankstellen entstehen, die – wie in Europa auch – allesamt grünen Wasserstoff «ausschenken». Start im grossen Stil soll 2022 sein. In Europa geht man von einem Bedarf von gut 70 Tankstellen aus, wobei der Netzausbau spätestens mit dem ersten Lastwagen im Jahr 2023 starten und irgendwann nach 2030 fertig ausgerollt sein soll. Aber alles der Reihe nach – nächster Stopp für Nikola ist die IAA Hannover Ende September.