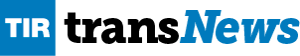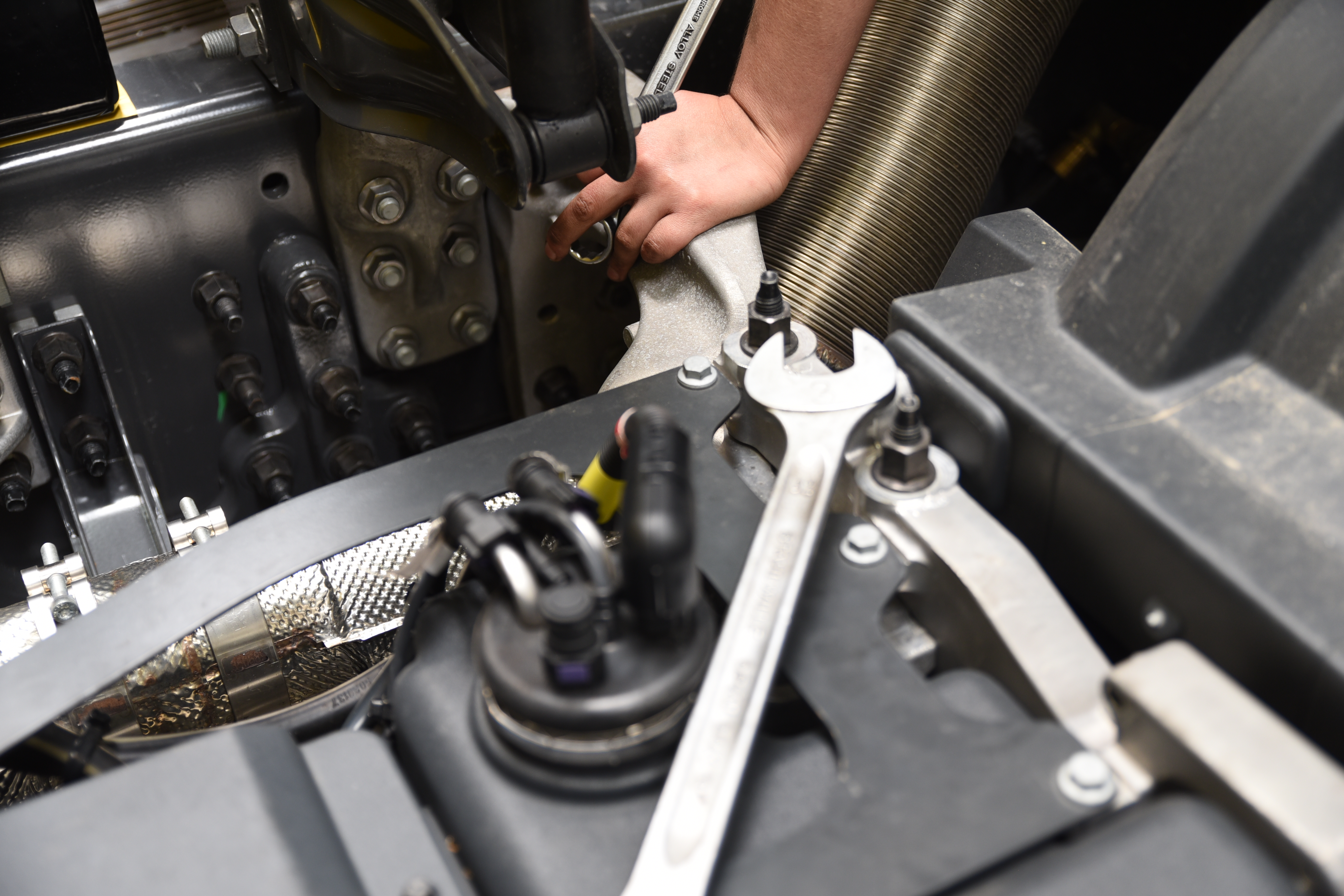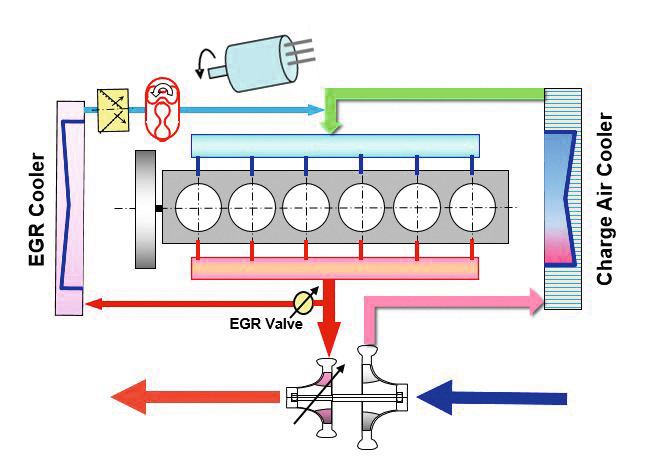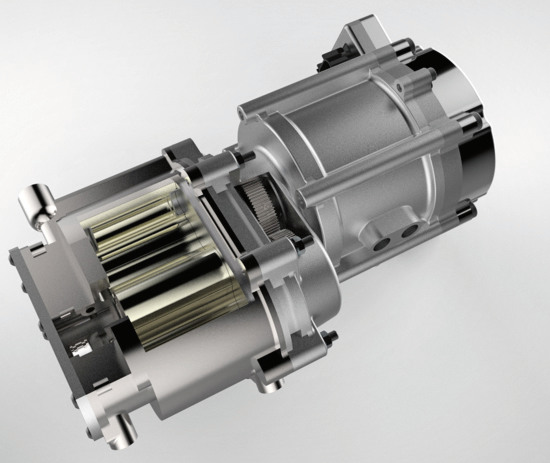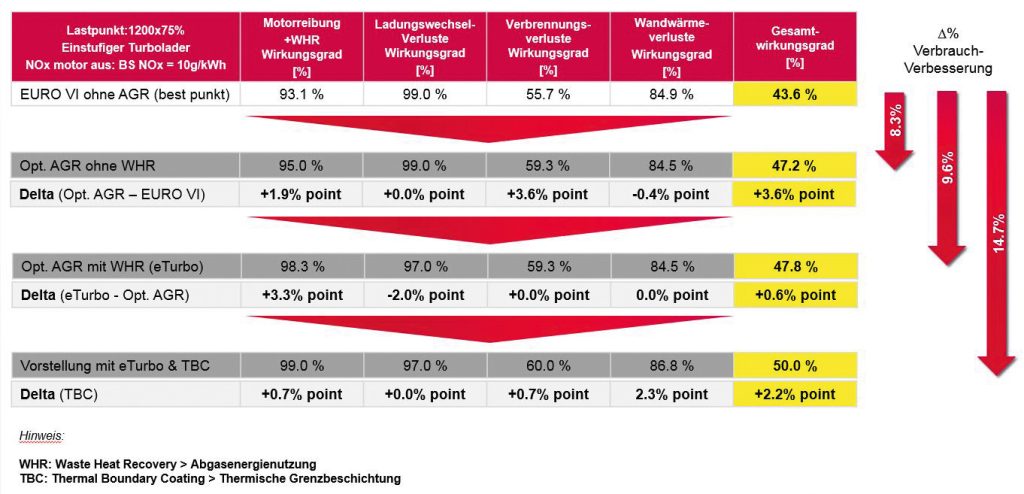«Das Schwierigste ist, das Vertrauen zurückzugewinnen»
REISEBUS-BRANCHE IM CORONA-LOCKDOWN Von allen Akteuren der Transportbranche wurden die Carhalter wohl am härtesten getroffen. Zwei Monate nach den bundesrätlichen Massnahmen sprachen wir mit Roger Kopf, Präsident der Astag-Fachgruppe Car Tourisme Suisse.

Als der Bundesrat Mitte März die ersten Massnahmen beschloss und umsetzte, versetzte er damit der Carreisebranche, die jährlich eine Bruttowertschöpfung von etwa einer Milliarde Franken verzeichnet, den K.-o.-Schlag. Von einem Tag auf den andern brach das Geschäft für die rund 400 Schweizer Unternehmen weg. Man hätte zwar noch Reisen durchführen dürfen, doch die Gäste blieben aus. Laut Roger Kopf, Präsident der Astag-Fachgruppe Car Tourisme Suisse und Inhaber der Kopf Reisen AG, hätten Vereinzelte noch beispielsweise einen Seniorenausflug mit Bewohnern eines Altersheims machen können. Doch es handelte sich dabei um eine Ausflugsfahrt ohne Zwischenhalt – die Passagiere seien nie ausgestiegen. Andere hätten sich an Rückführungen aus dem und ins Ausland beteiligen können, doch das seien die absoluten Ausnahmen gewesen. Heute sind praktisch alle Kontrollschilder der rund 3000 Schweizer Cars bei den Strassenverkehrsämtern deponiert. Auch Roger Kopf war direkt betroffen: «Wir sind ein eher kleines Unternehmen mit einem kleinen Reisekatalog. Wir haben dann angefangen, alles abzusagen, den Kunden ihr Geld zurückzuzahlen und unsererseits von Hotels unser Geld zurückzufordern. Das lief bei uns plus/minus gut, es gibt aber Kollegen, die warten noch heute auf ihr Geld, insbesondere von Flugreisen, da läuft die Rückzahlung harzig. Sie selbst sollten wiederum aber ihre Kunden bereits entschädigen. Mit den Gutscheinen ist es so eine Sache, wir haben eine mehrheitlich ältere Klientel, die nicht weiss, ob sie im nächsten Jahr noch mitfahren kann. Wir haben gewisse Reisen auf den Herbst verschoben, aber ob wir sie durchführen können, weiss ich nicht.» Kopf und seine Kollegen bewegen sich in einem saisonalen Geschäft. Im Jahr zuvor werden die Reisen fürs Folgejahr vorbereitet. Da steckt viel Vorbereitungsarbeit dahinter, die nun niemand bezahlt. «Bei grossen Veranstaltern mit mehreren Katalogen werden riesige Kosten auflaufen.» Was vielen zudem Sorge bereite, sei das laufende Leasing von Fahrzeugen. Er selbst habe Ende letzten Herbstes noch einen Reisecar bestellt, der diesen Februar ausgeliefert wurde: «Der neue Car hat noch keinen Meter gemacht, kostet aber Geld.» Das sind jeden Monat ca. 5000 Franken oder mehr, je nach Fahrzeug. Die Finanzierungsgesellschaften zeigen sich diesbezüglich wenig entgegenkommend. Will man Zahlungen aussetzen, gibt es neue Verträge mit höheren Raten. «Sie wollen Geld mit der Krise verdienen», so Kopf enttäuscht.

Glück hat, wer diversifiziert ist Kopf betreibt auch Schulbusse, so konnte er am 11. Mai, als die Grundschulen wieder öffneten, zumindest einen Drittel seines Umsatzes wiederbeleben. «Wer ein zweites oder drittes Standbein hat, also zum Beispiel für Postauto fährt, ist auf der besseren Seite.» Für die 4200 Vollzeitangestellten und die zahlreichen Teilzeit- und Aushilfsfahrer der Branche wurde praktisch vollumfänglich Kurzarbeit eingegeben. «Es gab ja nichts mehr zu tun», meint dazu Kopf. Der Alltag heute besteht hauptsächlich aus Büroarbeit, bei der man sich abwechselt, um die sporadischen Anrufe entgegenzunehmen sowie um die Rückzahlungen und eine Handvoll Offertanfragen zu bearbeiten.
Wie weiter? Hochsaison bei den Carreisen sind Frühling und Herbst. Nun hofft die Branche auf die Zeit von Mitte August bis Mitte Oktober. «Der grösste Hinderungsgrund sind die Abstandsregulierungen», gibt Kopf zu bedenken. «In Österreich beträgt der Mindestabstand 1,00 m, in Deutschland 1,50 und in der Schweiz 2,00. Warum? Wenn wir mit einem Meter arbeiten könnten, sind wir mit Reisebussen schon besser dran, dann könnten wir mit dem von der Fachgruppe erarbeiteten Schutzkonzept in einem Bus mit 50 Sitzplätzen gut 25 Passagiere befördern.» Doch ein weiteres Problem sei das der Gastronomie: Keine Carreise ohne Mittagessen, und die Restaurants sind flächenmässig mit ihren Abstandsvorschriften nicht auf allzu viele Gäste vorbereitet. «Solange diese Vorschriften bleiben, haben wir nur eine kleine Chance mit einem grossen Bus. Da braucht man fast eine ‹Turnhalle›, um den Abstand einzuhalten. Im Allgemeinen hängen wir an der Tourismusbranche und sie hängt an der Abstandsregulierung, da sehe ich das grösste Problem.»
Welche Auswirkungen das alles auf die Branche haben wird, könne man wohl erst in einem halben Jahr sehen, wenn der eine oder andere Mitbewerber aufgeben muss. Der Occasionsmarkt für Busse ist schon jetzt komplett zusammengebrochen. «Will jemand seinen Fuhrpark verkleinern, bekommt er momentan fast nichts für seinen Bus. Manche Importeure haben gar einen Rücknahmestopp.»
Der Bund habe gut reagiert, Notkredite sind sehr schnell gesprochen worden. «Auch weil unser Chef, Adrian Amstutz, Nationalrat ist, der hat das sehr gut gemacht, ich muss denen in Bern ein Kränzchen winden. Diejenigen, die uns gut gesinnt sind, haben uns gut Hand geboten.» Wenn das Geschäft nun langsam wieder anrollen soll, hängt alles davon ab, wie die Kunden reagieren. «Wir haben allen Mitgliedern das erarbeitete Schutzkonzept zugesandt und gesagt, sie sollen positiv auf ihre Kunden zugehen und ihnen sagen, wir seien bereit, wenn sie kommen wollen, wir freuen uns auf sie. Es ist jetzt sehr wichtig, dass wir unseren Kunden die Angst nehmen und ihr Vertrauen zurückgewinnen können. Das wird unsere grösste Herausforderung.» Mehrere Mails mit Fragen an den Verband, ob nicht die Schutzmasken gratis zu erhalten wären, musste er verneinen, denn bei 3000 Fahrzeugen mal Anzahl Plätze sind die Kosten zu hoch, als dass der Verband sie tragen könnte. Darum appelliert Kopf an die künftigen Passagiere: «Bitte bringen Sie Ihre eigene Maske mit!»

Mit der Wiedereröffnung von Tourismus und Gastronomie erhielt die Schweizer Reisebusbranche am 11. Mai wieder eine Perspektive. «Seit März waren die meisten Flotten aufgrund der staatlichen Corona-Einschränkungen stillgelegt», so Adrian Amstutz. «Ab heute gibt es wieder Ziele für Carfahrten, zumindest im Inland und für geschlossene Reisegruppen. Nach Wiedereröffnung von Gastronomie, Tourismus, Geschäften und Schulen freuen sich die Schweizer Carunternehmer auf möglichst viele Kunden.»
Zur Sicherheit der Kunden wird ein umfassendes Schutzkonzept angewendet, erarbeitet durch den Schweizerischen Nutzfahrzeugverband (Astag). Oberste Priorität habe dabei die Gesundheit der Kundinnen und Kunden wie auch des Fahr- und Begleitpersonals. Das Risiko einer Ansteckung mit COVID-19 soll so gering wie möglich gehalten werden – zumal Carreisen nebst einer zunehmenden Attraktivität für ein jüngeres Publikum bekannterweise vor allem bei älteren Menschen äusserst beliebt sind. Zentrale Bestandteile des Schutzkonzeptes sind unter anderem die regelmässige Reinigung der Fahrzeuge, die Desinfektion sämtlicher Berührungspunkte, das Einhalten von Abstand sowie die persönliche Händehygiene.
Das Versammlungsverbot für Gruppen von über 5 Personen gemäss Abs. 7c der COVID-19-Verordnung 2 gilt für den «öffentlichen Raum». Carfahrten mit mehr als 5 Personen, darunter die Beförderung von Schülerinnen und Schülern, finden nicht im öffentlichen Raum statt und sind somit zulässig. Für den Besuch von Restaurants sind die Bestimmungen der Gastronomie zu beachten.