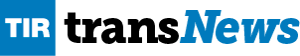CO2-Ziele: Entscheid mit sehr vielen Unbekannten
POLITIK Dass CO2-Ziele für schwere Lastwagen eingeführt werden, ist auch in der Fahrzeugindustrie unbestritten. Die am 18. Februar von der EU beschlossenen, sehr ambitionierten Zielvorgaben und der Mangel an begleitenden Massnahmen jedoch verursachen tiefe Sorgenfalten.

Die Nutzfahrzeugindustrie wird in der Öffentlichkeit eigentlich meist nur als Störfaktor wahrgenommen. Dass Last- und Lieferwagen jedoch die tragende Stütze für eine florierende Wirtschaft sind, das wollen viele Menschen erst gar nicht wahrhaben. Anders als beim Personenwagen werden Nutzfahrzeuge nicht angeschafft, weil man sie mag, sondern deshalb, weil man ein Geschäft betreibt und von diesem Geschäft leben will oder muss. Entsprechend sind Nutzfahrzeughersteller seit jeher bestrebt, Produkte auf den Markt zu bringen, die dem Kunden helfen, Geld zu verdienen. Und da heute der Treibstoff generell für rund ein Drittel der Gesamtkosten eines Transportunternehmens steht, arbeiten alle Hersteller schon lange daran, hier kontinuierlich Verbesserungen zu bewirken. Und das ohne eine gesetzliche Verbrauchsvorgabe, wie sie jetzt in Europa beschlossen wurde.
Seit die erste Abgasklasse Euro 1 Anfang 1992 eingeführt worden war, hat die ganze Industrie die Verbräuche ihrer Lastwagen um rund ein Fünftel reduziert, was einer jährlichen Reduktion im Schnitt von rund einem Prozent gleichkommt. Zugleich wurden über 95 Prozent des NOx- und Partikel-Ausstosses pro Lastwagen eliminiert. Die neuen Vorgaben, die in Brüssel Mitte Februar nach langen Diskussionen beschlossen wurden, sehen eine Verdreifachung der bislang im Schnitt jährlich erwirkten Reduktion des CO2-Ausstosses vor: Bis 2025 um 15 und bis 2030 um 30 Prozent. Noch nicht definiert ist die Referenz, aber man geht davon aus, dass das aktuelle Jahr 2019 als Basis dienen wird.
Die Politik muss mithelfen
In der Branche ist man sich einig, dass das Erreichen der CO2-Ziele extrem anspruchsvoll sein wird und hohe Investitionen erfordert. Zudem geht man davon aus, dass die Ziele ohne neue Antriebssysteme nicht realisierbar sind. «Die erfolgreiche Umsetzung hängt aber nicht von der Nutzfahrzeugindustrie alleine ab», sagt auch Erik Jonnaert, Generalsekretär der Europäischen Automobilhersteller-Vereinigung ACEA. Er fordert die 28 EU-Regierungen auf, sich raschestmöglich auf einen europaweiten Infrastrukturplan zu verständigen, mit Ladestationen für Elektro- und Tankstellen für LNG/CNG-Lastwagen. Die ACEA kritisiert zudem, dass die EU zwar erstmals CO2-Ziele erlassen hat, Entscheide über begleitende Massnahmen, wie längere Fahrzeugkombinationen oder alternative Treibstoffe, aber auf frühestens 2025 verschiebt.
Jonnaert kritisiert zudem, dass die Gesetzgebung die Nachfrage komplett ausser Acht lässt. «Wir können nicht erwarten, dass Transportunternehmer plötzlich Elektro-LKW oder alternative Antriebe kaufen, wenn sie darin keinen Business Case sehen und wenn entlang der Hauptverkehrsachsen keine Lade- und Tankinfrastruktur besteht.»
Wirtschaftlichkeit
Die LKW-Hersteller verfolgen unterschiedliche Ansätze, wobei Elektro-Trucks die grössten CO2-Einsparungen bringen würden. «Technisch ist es ein Einfaches, eine Lösung für Elektro zu finden», sagt etwa Martin Daum, Vorstand Daimler Trucks & Buses. «Sobald wir auch eine wirtschaftliche Lösung finden, wird der Wechsel von Diesel auf Elektro automatisch erfolgen. Sobald …» Erdgas wiederum hat zuletzt wegen jetzt Diesel-ähnlicher Motorperformance an Bedeutung in der Branche zugenommen. Erdgas reduziert CO2 um 15 bis 20 Prozent, bei Verwendung von Biodiesel Well-to-wheel gar bis 95 Prozent. Zudem fallen 70 Prozent weniger Partikel an und beim NOx sind es 90 Prozent weniger.
Eine zusätzliche Forderung an die Behörden äussert Volvo Trucks. «Die neuen Technologien zur CO2-Reduktion müssen schnell in die Märkte eingeführt werden», sagt Lars Mårtensson, Direktor Umwelt und Innovationen bei Volvo. «Beschleunigte Prozesse und Zertifizierungen von neuen Technologien durch die Behörden würden deren Einführung im Transportsektor erleichtern.»