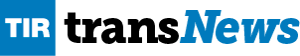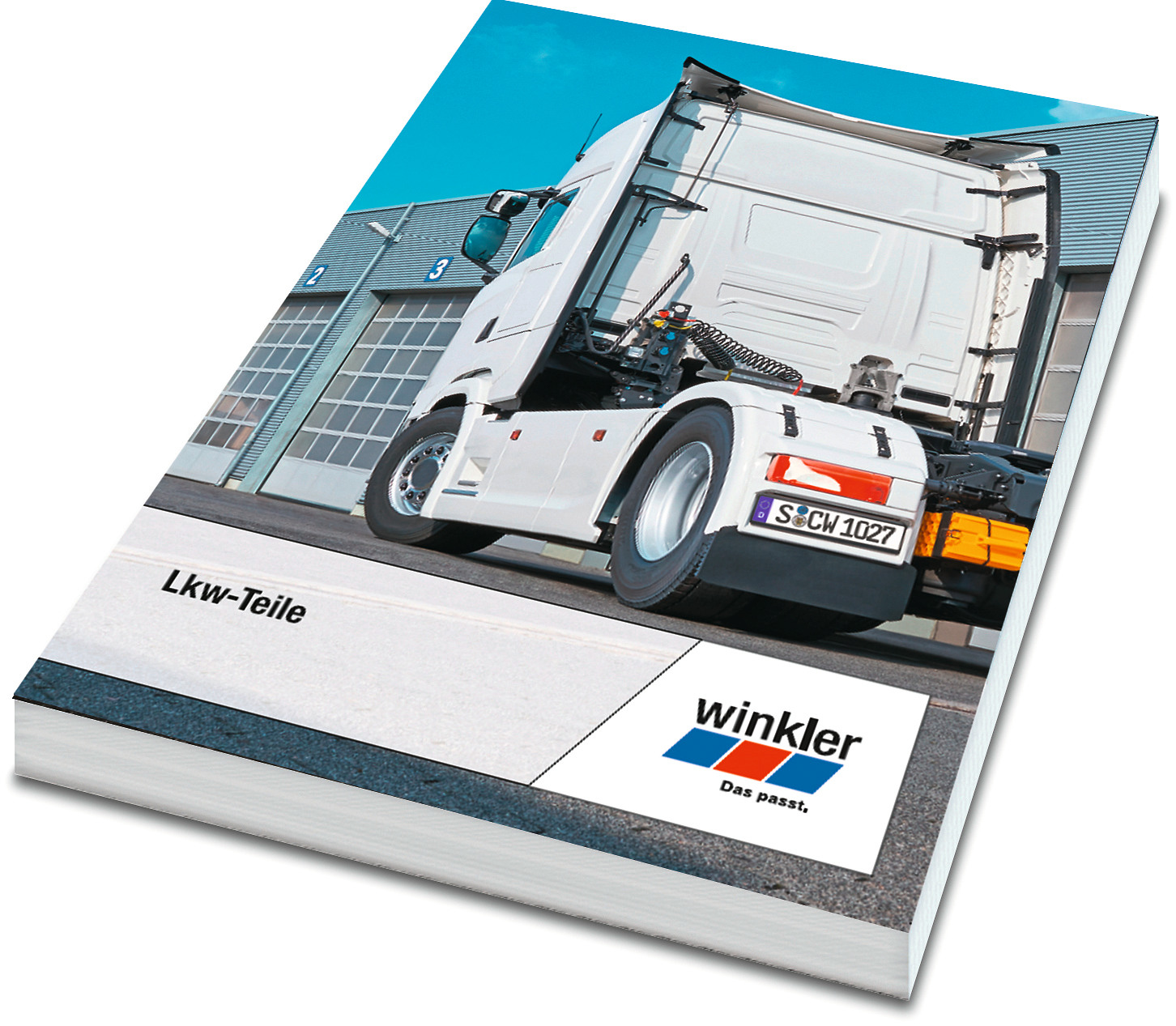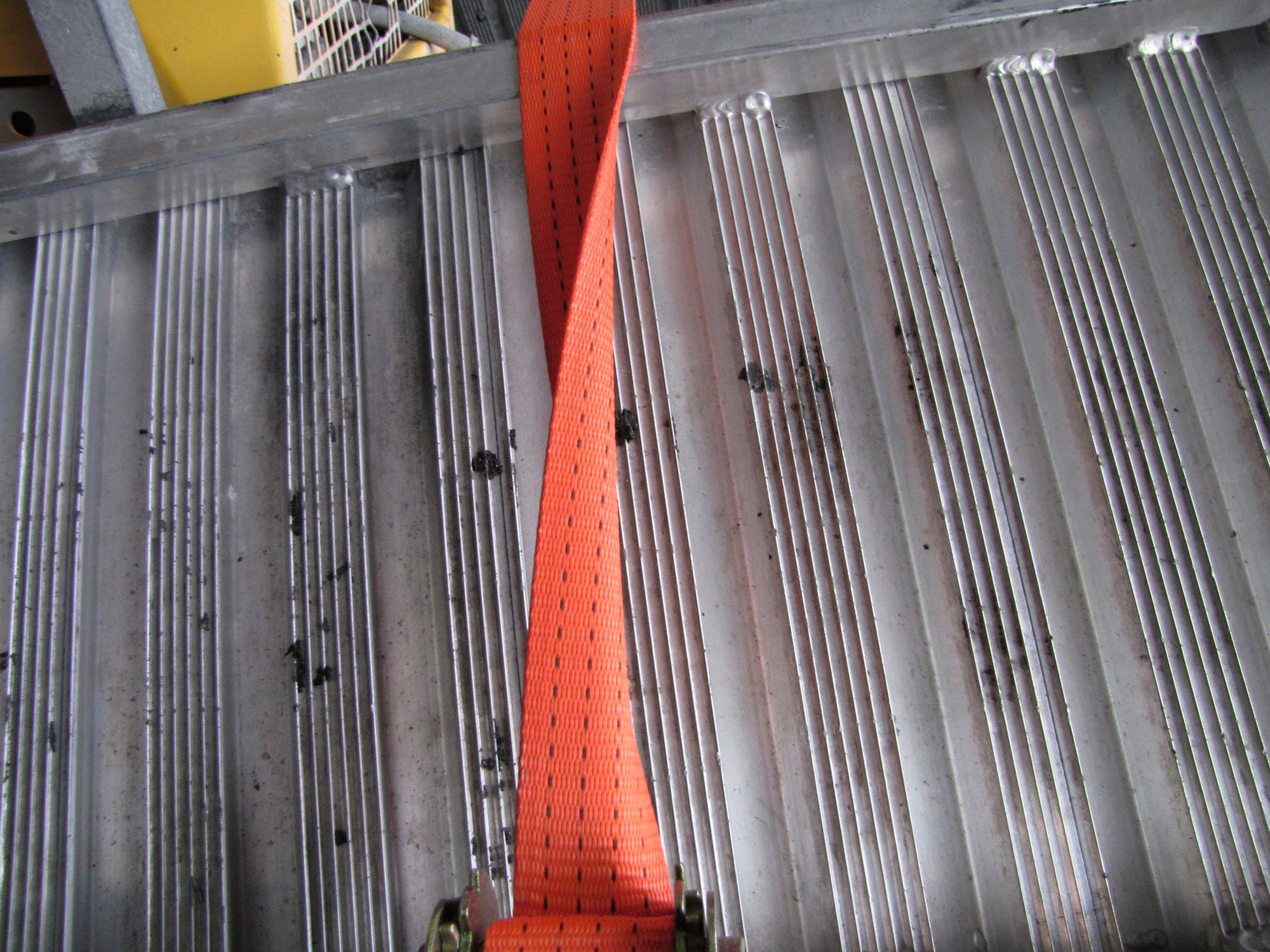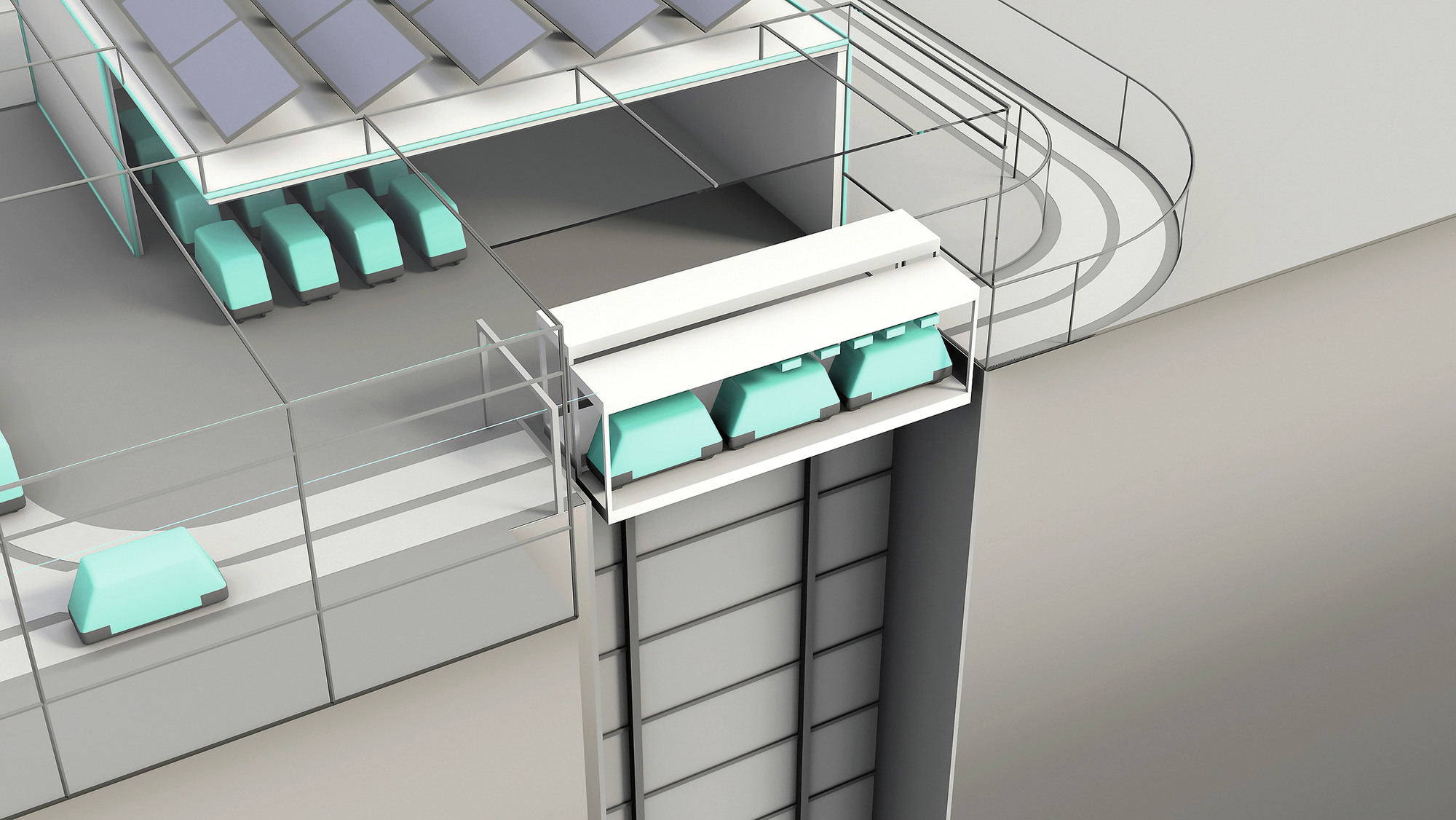Die Verbände geben bei CZV-Kursen den Ton an
CHAUFFEURZULASSUNGSVERORDNUNG Der Schweizer Nutzfahrzeugverband Astag und der Berufsfahrerverband Les Routiers Suisses (LRS) sind die grössten Anbieter von CZV-Kursen in der Schweiz. Wir befragten zum Thema Astag-Vizedirektor Gallus Bürgisser und LRS-Generalsekretär David Piras.

Wie hat sich die Qualität der Berufsfahrer seit Einführung der CZV-Kurse verändert?
Bürgisser: In den letzten zehn Jahren konnte bei Strassenverkehrsunfällen mit schweren Motorfahrzeugen ein Rückgang der schweren Personenschäden von 36 Prozent verzeichnet werden. Weiter hat sich die Zahl der Arbeitsunfälle seit der Einführung der CZV im Jahr 2009 um neun Prozent gesenkt. Insofern haben die unzähligen Fahrerweiterbildungen sicherlich zur Erhöhung der Verkehrs- und Arbeitssicherheit beigetragen. Ein Hauptproblem bleibt jedoch das Branchenimage. Dieses ist zwar in den letzten Jahren besser geworden, aber aufgrund äusserer Einflüsse wie Stau, Stress oder gezielter Diffamierung ist der Fahrerberuf noch immer zu wenig attraktiv für Jugendliche und Quereinsteiger. Das ist bedauerlich.
Piras: Das Verantwortungsbewusstsein ist gestiegen. Die eigene Arbeit wird bewusst hinterfragt und selbst verbessert. Veränderungen der Aufgaben von Seite Arbeitgeber werden besser aufgenommen. Das Verständnis für die Organisation innerhalb der Firma und den Umgang mit Kunden ist gestiegen. Räubergeschichten vom Stammtisch sind weniger geworden, der Strassentransport wurde professionalisiert.

Welche Auswirkungen hat dies auf die Arbeitgeber?
Bürgisser: Mit der CZV-Einführung wurde die Eintrittshürde in den Fahrerberuf klar erhöht und auch die Kosten aufgrund des Aus- und Weiterbildungsaufwands sind gestiegen. Das hat zur Folge, dass Privatpersonen oft nicht mehr in der Lage sind, diese Mehrkosten selber zu tragen. Hinzu kommt, dass über 60 Prozent der aktuellen Berufsfahrerinnen und -fahrer in den nächsten 20 Jahren pensioniert werden. Im Gegenzug wächst die Transport- und Logistikbranche und damit wird auch der Mitarbeiterbedarf immer grösser. Jährlich werden rund 5350 zusätzliche Berufsfahrerinnen und -fahrer benötigt, um die Kundenbedürfnisse im Personen- und Gütertransport abdecken zu können.
Über die Berufslehre Strassentransportfachmann/-frau EFZ, die übrigens im letzten Jahr das 50-jährige Jubiläum feiern durfte, kommen jährlich nur gerade rund 250 Personen in die Branche. Den Rest müssen die Unternehmen via Quereinsteiger, Militär oder aus dem Ausland rekrutieren.
Piras: Vorgesetzte getrauen sich weniger, Aufgaben zu stellen, die unter Einhaltung der Gesetze nicht machbar wären. Disponenten wissen, dass auch Chauffeure auf gutem Wissensstand sind. Das Verständnis für einen Einwand oder Vorschlag eines Chauffeurs ist eher vorhanden.
Wodurch zeichnet sich Ihr Angebot aus?
Bürgisser: Als Branchenverband mit 15 Fachgruppen vom Personen- bis zum Ausnahmetransport steht innerhalb unserer Organisation sehr viel Fachwissen zur Verfügung. Ob Basic, Premium oder Hightech: Mit über 100 unterschiedlichen Kursthemen bieten wir eine massgeschneiderte und praxisbezogene Weiterbildungspalette für Allrounder und Spezialisten an.
Piras: Die Inhalte sind praxisorientiert. Kurse werden von Kursleitern gegeben, die Praxisbezug zum Strassentransport und entsprechende Erfahrung haben. Fahren können die meisten Chauffeure bestens. Die Probleme liegen bei den Zusatzaufgaben, die zur Arbeit dazugehören und Einfluss auf die Fahrweise haben können. Wir haben unsere Kurse grundsätzlich selbst aufgebaut und haben dabei die alltäglichen Sorgen der Chauffeure und Arbeitgeber im Fokus. Zudem geht es uns nicht ums Vermitteln von Theorie, sondern mehr um die Umsetzung im Arbeitsalltag.
Wer führt die Kurse durch?
Bürgisser: Aufgrund der rund 110 000 Fahrerinnen und Fahrer, die innerhalb von fünf Jahren jeweils fünf CZV-Kurse absolvieren müssen, ist in den letzten Jahren richtiggehend ein «Weiterbildungsrausch» ausgebrochen. Entsprechend sind aktuell über 240 Anbieter am CZV-Weiterbildungsmarkt aktiv. Die Astag hat sich schon von Beginn weg die Weiterbildung auf die Fahne geschrieben. Als Arbeitgeberverband hat sie den Fokus auf interne Firmenkurse gelegt. Obwohl der Strassentransport eine klassische KMU-Branche ist, sind Firmenkurse auch bei kleineren Betrieben sehr beliebt, da diese noch spezifischer gestaltet werden können. Für Einzelteilnehmer bieten wir in sämtlichen Sprachregionen Weiterbildungsmöglichkeiten in unseren Kompetenzzentren an.
Piras: Öffentliche Kurse führen wir in eigener Regie oder zusammen mit unseren Sektionen durch. In Echandens und Würenlos verfügen wir über sehr gute eigene Räumlichkeiten, die Sektionen mieten für die Kurse Lokale in ihrer Region. Kurse für Unternehmungen finden im Allgemeinen in Lokalitäten des Auftraggebers statt. Die Kurse werden bei uns von unseren angestellten Kursleitern gegeben.
Was ist besonders gefragt?
Bürgisser: In der ersten Fünf-Jahres-Periode waren eher Standardthemen wie Arbeits- und Ruhezeitverordnung ARV, Ladungssicherung und Verkehrsvorschriften gefragt. In der aktuellen Periode haben wir jedoch eine Verlagerung zu branchenspezifischen Themen, die auch im Betrieb einen Mehrwert bringen, festgestellt. Die Befürchtung, dass die Berufsfahrerinnen und -fahrer fünfmal den günstigsten Kurstyp hintereinander wählen, ist also nicht eingetroffen.
Piras: ARV ist ein Dauerbrenner. Die Regelungen sind kompliziert und man sollte die mögliche Flexibilität nutzen. Auch technische Kurse oder Kurse zur Arbeitssicherheit sind immer gut besucht. Kurse zum Umgang mit Kunden und zur Persönlichkeitsförderung kommen auch immer mehr. Uninteressante Themen werden bei uns auf dem Programm gestrichen, da wir interessante Themen weiterentwickeln.
Gab es bezüglich des Angebots Veränderungen?
Bürgisser: In den letzten Jahren waren immer wieder Bestrebungen von Weiterbildungsanbietern und Behörden im Gang, die Themenvielfalt in der Schweiz einzuschränken. Die Astag hat sich als einzige Organisation dafür eingesetzt, dass Branchenthemen wie Gefahrgut, Stapler und Lastwagenladekrane weiterhin angerechnet werden können – mit Erfolg! An der aktuellen Bewilligungspraxis wird hierzulande nichts geändert. Auch in Brüssel hat die EU-Kommission signalisiert, dass die bestehenden Vorschriften über die Aus- und Weiterbildung von Berufsfahrerinnen und -fahrern überarbeitet werden sollen. In Bezug auf die Anerkennung von Branchenthemen ist eine Lockerung vorgesehen und Gefahrgutkurse sollen nun in der EU ebenfalls teilweise angerechnet werden.
Auch die Digitalisierung verändert den Weiterbildungsbereich merklich. Die Astag hat sich bei den Behörden dafür eingesetzt, dass sich die Kursteilnehmenden künftig den Theorieteil mit eLearning selber aneignen können. Als einzige Organisation kann unser Verband aktuell einen CZV-anerkannten eLearning-Kurs anbieten. Das Produkt Astag eLearning ermöglicht die individuelle und flexible Vorbereitung auf den CZV-Kurs von überall. Im anschliessenden Präsenzkurs werden die Lerninhalte anhand praktischer Beispiele angewendet und die neusten Entwicklungen vermittelt. Dank dieser kombinierten Lernmethode kann an einem halbtägigen Präsenzkurs gleich ein CZV-Kurstag absolviert werden.

Piras: Das Angebot ist in den letzten Jahren in die Breite gegangen. Inzwischen haben wir rund 25 verschiedene Kurse im Angebot. Verschiedene Anbieter haben versucht, Kurstage mit verschiedensten Inhalten zu mischen. Dadurch konnte kein Thema ernsthaft angepackt werden. In letzter Zeit stellen wir fest, dass auch Kurse mit branchenfremden Inhalten durchgeführt werden. Wir bieten Kurse für gute Chauffeure und keine Kurse für Gerüstbauer mit Führerschein. Wir gehen davon aus, dass sich auch die ASA wieder eher für «Back to the Roots» einsetzt.
Gesetzliche Anpassungen werden bei uns laufend in die betreffenden Kurse eingebaut. Wer einen Kurs besucht, weiss, dass er in diesem Bereich auf dem neuesten Stand ist. Sicher wird die Zukunft vor allem zum Thema «autonomes Fahren» für Chauffeure noch einiges bereithalten. Zum einen geht es um das eigene Fahrzeug, aber auch um Verkehrspartner und der Verkehrsfluss wird sich ändern. Neue Antriebe werden kommen und eine andere Fahrweise implizieren. Die wirtschaftliche Situation hat kaum Einfluss auf die Kursinhalte.
Wer bezahlt erfahrungsgemäss die Kurse?
Bürgisser: In der Landesvereinbarung haben sich die Sozialpartner Astag und Les Routiers Suisses LRS darauf geeinigt, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die für die CZV-Weiterbildungskurse notwendige Zeit zur Verfügung stellt. Weitergehende Bestimmungen – insbesondere die Übernahme der Kurskosten durch den Arbeitgeber und die anteilsmässige Kostenübernahme durch den Arbeitnehmer nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses – werden im Einzelarbeitsvertrag oder in den Ergänzenden Bestimmungen der Sektionen festgelegt.
Piras: Zwei Drittel der Kurse werden vom Arbeitgeber bezahlt. Rund einen Drittel der Kurse verrechnen wir direkt an die Teilnehmer. Wir gehen davon aus, dass von diesem Drittel die Hälfte beim Arbeitgeber abgerechnet wird. Somit werden 80 bis 90 Prozent der Kurse von den Arbeitgebern bezahlt. Nicht alle Arbeitgeber zahlen den Arbeitstag. Kann ein Chauffeur Thema und Termin selbst wählen, ist er häufig bereit, den Kurs während der Freizeit zu besuchen.
Welche Vorteile sehen Sie beim Schweizer System gegenüber demjenigen im Ausland?
Bürgisser: Anders als in der Schweiz müssen in den meisten EU-Ländern alle fünf Jahre immer wieder die gleichen fünf Kursthemen besucht werden. Angesichts der grossen Branchenvielfalt und der unterschiedlichsten Transportgüter ist dies absolut praxisfremd – denn was hat der Tankwagenfahrer für einen Mehrwert, wenn er alle fünf Jahre einen Stückgut-Ladungssicherungskurs besuchen muss? Keinen! Daher wird die Astag auch in Zukunft weiterhin alles daran setzen, dass die Anerkennungspraxis in der Schweiz praxisbezogen bleibt. Durch der Vielzahl von Anbietern besteht leider auch Missbrauchspotenzial. So werden offensichtlich unter der Rubrik «Softthemen» Grillkurse oder Powernap-Lektionen angeboten. Die Astag unterstützt daher die Behörden, dass die Qualitätsschraube bei sämtlichen Anbietern durchaus angezogen werden kann.
Piras: Ich sehe nur Vorteile. Die Kursanbieter kümmern sich um die Einschreibung, es besteht eine zentrale Datenbank und Ausweise können per Internet bestellt werden. Themen können nach Bedarf gewählt werden, auch ein doppelter Besuch eines Themas in einer Fünf-Jahres-Periode ist kein Unfall. Die freie Themenwahl wurde nicht missbraucht. Wir haben bei der Einführung auf einem solchen Aufbau bestanden.
Hier geht es zum ganzen Astag-Kursangebot. Auf www.routiers.ch finden sich unter «Aus/Weiterbildung» die CZV- Kursbroschüre und die Preisliste zur Ansicht und zum Download.