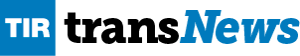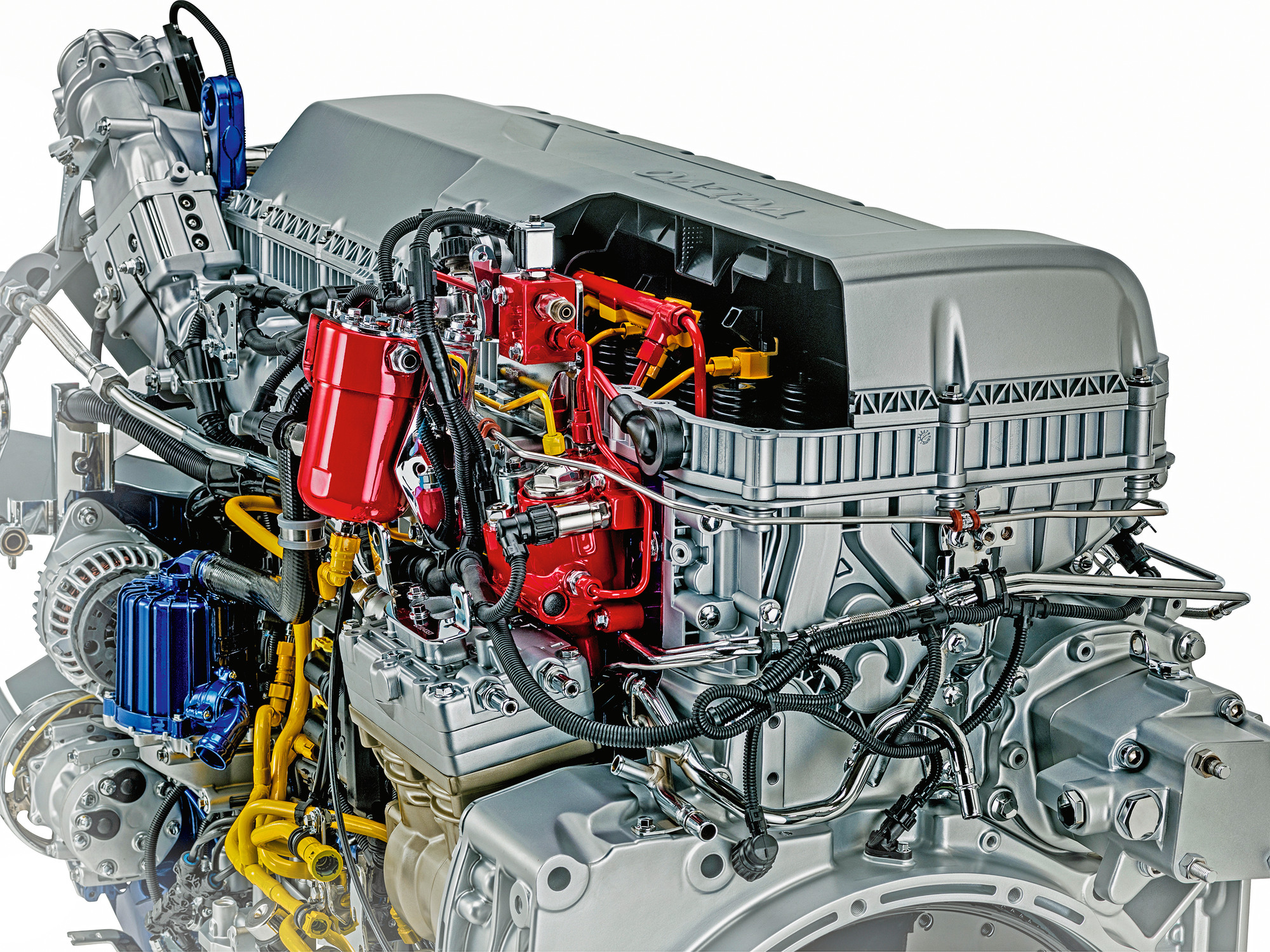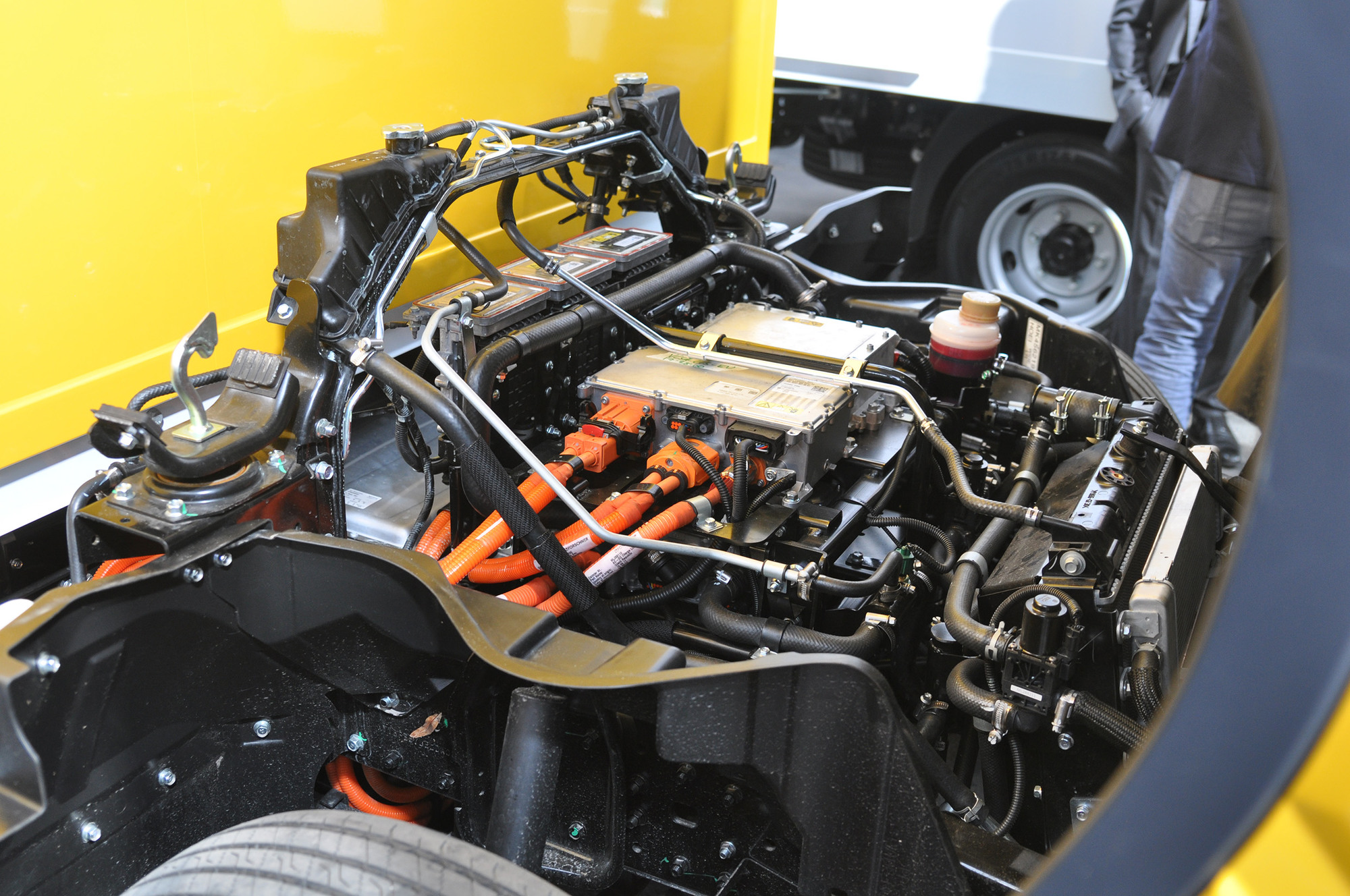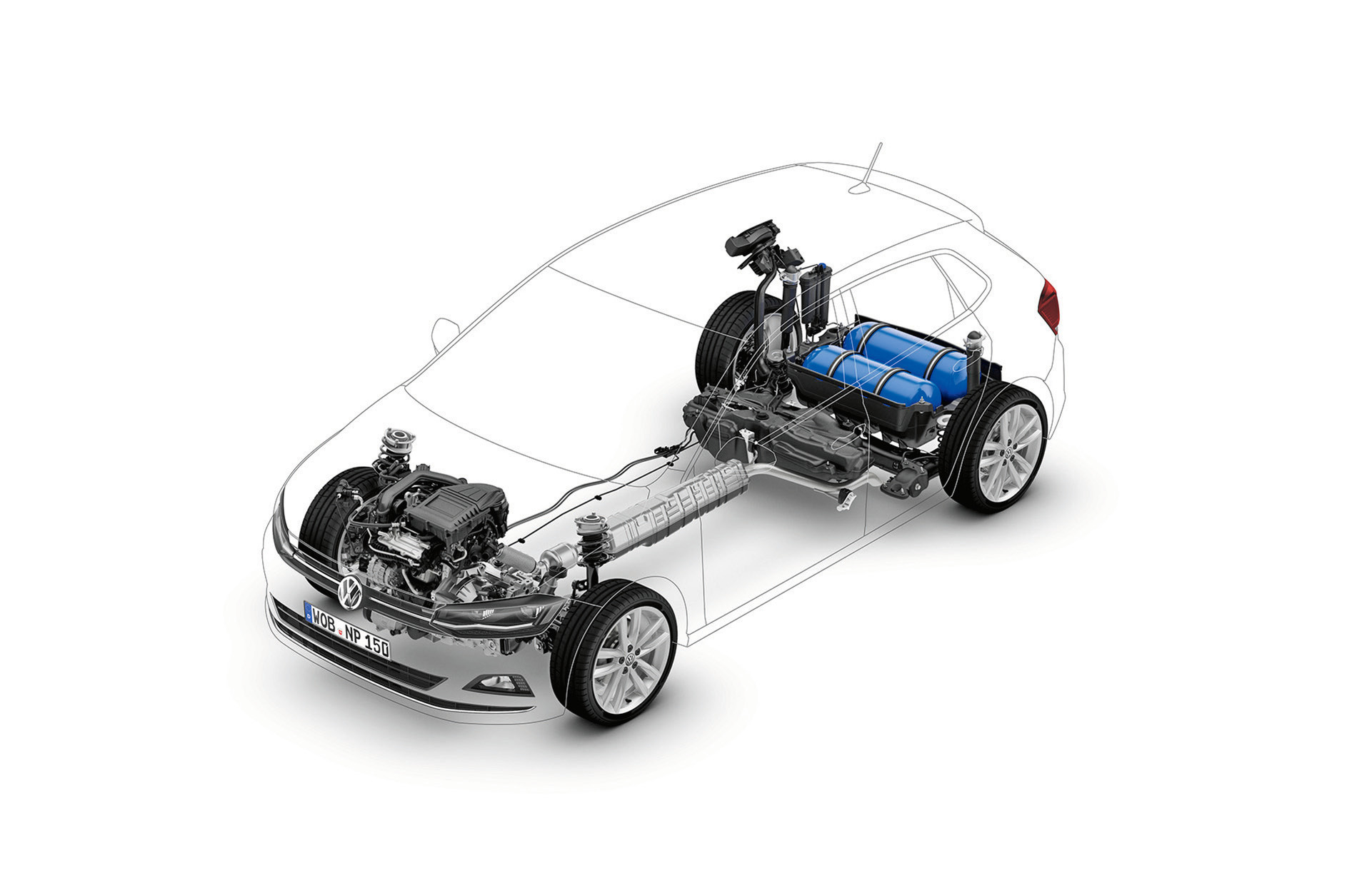Extrem wendiger Tatra: die etwas andere Allradlenkung
TATRA Die schwere LKW-Baureihe Tatra Phoenix Euro 6 wurde für die Schweiz um ein sehr interessantes und hochkomplexes Fahrwerkskonzept erweitert – eine vierachsige Ausführung mit Allradantrieb und Allradlenkung.

Für das Kranunternehmen Zürrer GmbH aus Würenlingen hat der Aufbau- und Kranspezialist Hodel Betriebe AG in Grosswangen ein spezielles, mit Effer-Kran bestücktes Fahrzeug entwickelt, das auf der transport-CH letzten Herbst zweifelsohne ein besonderer Blickfang war. Dafür ist vor allem das Basisfahrzeug verantwortlich. Der tschechische Hersteller Tatra Trucks hat ein Fahrzeug der schweren LKW-Reihe Phoenix Euro 6 mit einer speziellen Lenkung ausgestattet, die aus einer mechanischen Lenkung der Vorderachsen und einer elektrohydraulischen Lenkung beider Hinterachsen besteht. Dadurch ergeben sich Lenkmöglichkeiten, die sich sehen lassen können. Im Vorfeld der Auslieferung ermöglichte uns Radomír Smolka, Vorstandsvorsitzender und technischer Direktor von Tatra Trucks, den Lastwagen und sein aussergewöhnliches Lenktalent hautnah selber zu erfahren. Ein Probefahrtangebot, dem man kaum widerstehen kann.
Ohne etwas Schulung kein Erfolg
Obwohl das Fahrgestell auf den ersten Blick ganz konventionell wirkt, machen die kombinierten Lenksysteme TatraTON und Mobile Electronic aus dem Fahrzeug ein Sondergerät, das eine kurze technische Vorstellung verdient. Das Fahrwerk ist ein T 158-8P6R41.27ZA 8×8.1R mit den Radständen 2150/2660/1500 mm.
Mit dem mechanischen Lenksystem TatraTON an den Vorderachsen und dem elektrohydraulischen Lenksystem Mobile Electronic an beiden Hinterachsen ermöglicht diese spezielle Allradlenkung unter anderem die krabbengang-ähnliche Fortbewegung (auch «Hundegang» genannt, Anm. d. Red.). Die Räder der beiden Hinterachsen nehmen auf Wunsch denselben Lenkwinkel wie die Vorderräder ein, sodass sich der Lastwagen schräg nach vorne oder nach hinten bewegt, nach links oder nach rechts. Aus Sicherheitsgründen und auch wegen der gesetzlichen Vorgaben sind die anwählbaren Lenkmodi in die zwei Gruppen «On-Road» und «Off-Road» unterteilt.

Mit dem Tatra auf die Strasse und ins Gelände
Der Lenkmodus «On-Road» ist der Ausgangsmodus, den das Fahrzeug nach jedem Motorstart automatisch anwählt. Er ist für den Betrieb auf den normalen Strassen und auf befestigten Wegen bestimmt. Die Lenkung der dritten Achse ist in diesem Modus in der Direktfahrtposition verriegelt. Die Räder der vierten Achse werden zwischen Tempo 30 und 50 km/h in Abhängigkeit vom aktuellen Lenkwinkel der Vorderachse gelenkt, was dem üblichen Nutzen einer gelenkten hintersten Achse entspricht und beispielsweise den Abrieb der Reifen mindert. Oberhalb von 50 km/h wird die vierte Achse wieder automatisch zentriert und die Lenkung verriegelt. Unter «On-Road» sind keine weiteren Lenkvarianten anwählbar.
Das ist beim Modus «Off-Road» anders. Drei weitere Lenkvarianten sind für die langsame Fahrt im Gelände bestimmt:
- Die Lenkvariante «All-Wheel Steering», also die Allradlenkung, bietet die Möglichkeit, die Räder der beiden Hinterachsen in Abhängigkeit vom aktuellen Lenkwinkel der Vorderräder so zu lenken, dass der kleinste Wendekreis erreicht wird.
- Die Lenkvariante «Crab Steering», Krabbenlenkung, ermöglicht eine krabbengangähnliche Fortbewegung, indem die Räder der dritten und vierten Achse unter dem Winkel 0 bis 21 Grad eingelenkt werden und in dieselbe Richtung wie die Räder der Vorderachsen zeigen.
- Die letzte Sonderlenkvariante heisst «Manual Steering», manuelle Lenkung. Die Räder der dritten und vierten Achse werden in diesem Modus unabhängig von der Stellung der Vorderräder gelenkt. Nachdem die Räderposition der dritten und vierten Achse bestimmt worden ist, kann der Chauffeur die Fahrtrichtung mit dem Lenkrad korrigieren, indem er die Vorderräder ändert, die hinteren Räder behalten ihre Lenkposition bei.
Das Hydrauliksystem der Hinterachsen wird elektronisch gesteuert. Das Bedienungsterminal des Mobile-Electronic-Lenksystems befindet sich im Fahrerhaus auf dem Mitteltunnel neben dem Schaltknauf. Mit acht beleuchteten Funktionstasten werden die einzelnen Lenkvarianten angewählt und dann die Lenkung der dritten und vierten Achse bedient. Im Display oberhalb der Tasten werden die einzelnen Aktivierungen angezeigt.

Systemprüfung und Synchronisierung
Um die hohe Betriebssicherheit zu gewährleisten, wird das gesamte System nach dem Motorstart für rund 15 Sekunden durch die Fahrzeugelektronik getestet. Während dieser Zeit bewegt sich der vierachsige Lastwagen nicht. Die einzelnen Lenkmodi lassen sich beim stehenden Fahrzeug, aber auch bis 5 km/h anwählen. Nach jedem Rangieren im Lenkmodus «Off-Road» sollte der Fahrer zurück in den «On-Road»-Modus schalten, damit sich das Lenksystem «synchronisieren» kann. Erst danach ist es wieder möglich, eine öffentliche Strasse zu befahren.
Das System verfügt über einen Eigentest- und Synchronisierungsmodus. Dieser wertet Fehlerzustände aus, zeigt die Fehlercodes an und gibt im Bedarfsfall auch akustische Warnungen an den Fahrer ab.
Den richtigen Lenkmodus wählen
Aus diesem kurzen Beschrieb des Bedienungssystems für die diversen Lenkmodi wird eines ersichtlich: dass es sich um ein hochkomplexes und hochspezialisiertes Fahrzeug handelt. Vom Fahrer wird entsprechend ein hohes Mass an Eigenverantwortung gefordert und Fingerfertigkeit im Umgang mit den Bedienelementen.
Während sich der schwere Lastwagen im «On-Road»-Lenkmodus relativ konventionell bewegen lässt und vom Fahrer nicht mehr als das übliche Vorstellungsvermögen verlangt, bietet der Tatra im «Off-Road»-Lenkmodus eine aussergewöhnliche Manövrierbarkeit, die für Fahrzeuge mit herkömmlicher Lenkung undenkbar wäre. Das sind beispielsweise das präzise Rangieren seitlich zur Laderampe und der minimale Wendekreis. Dazu kommt das Meistern kritischer Situationen im schwersten Gelände, wie das seitliche Verlassen von tief eingefahrenen Spuren oder die Bewältigung von Steigungen seitlich zum Hang.
Im Werk in Tschechien ist man überzeugt, dass die «Krabbe» Tatra Phoenix Euro 6 in unserer bergigen Schweiz eine Idealbesetzung ist. Hier kann der Speziallastwagen seine einzigartigen Fahreigenschaften unter Beweis stellen.
Fahrpraxis und Eindrücke im Tatra
Uns stand das Fahrzeug noch ohne Aufbau zur Verfügung. Wir haben mit ihm das Tatra-Testgelände unsicher gemacht, wobei sich uns die Möglichkeit von Strassenfahrt, aber auch von leichtem Geländeeinsatz boten. Für die grosse Action im schweren Gelände aber fehlte der Kranaufbau.
Der Truck lässt sich – mit Ausnahme der Lenkung – ganz konventionell mit Handschaltung bewegen. Die Wahl der einzelnen Lenkmodi hängt nur vom Fahrer ab. Dabei ist zu betonen: Je mehr Möglichkeiten, desto höher wird auch die Verantwortung des Fahrers. Wir haben es nicht eilig und lassen die Zeit für die obligate Test- und Synchronisierungsphase geduldig verstreichen. Bereits die Wahl des passenden Lenkmodus verlangt zwar Erfahrung, kann aber auch nach einer kurzen Einführung mit logischer Denke umgesetzt werden.
Die wirkliche Herausforderung ist der auch optisch spektakuläre «Krabbengang». Hier gilt es, den richtigen Lenkwinkel der Vorderräder zu finden, weil sich sonst das Fahrzeug nicht nur seitlich vorwärts bewegt, sondern zugleich auch noch abbiegt. Und schliesslich kann der Phoenix von Tatra nicht nur den Krabbengang, dank des manuellen Modus lässt sich der Truck auch nur mit den Hinterrädern lenken. Ziemlich ausgefallen, und es dürfte ein spezielles Ereignis sein, diesen Tatra in der Schweiz im Einsatz beobachten zu können.
Hier geht’s zur Schweizer Tatra-Seite.