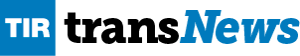Hupac-Jahresergebnis 2018 mit Warnzeichen
HUPAC JAHRESERGEBNIS Die Verlagerung von der Strasse auf die Schiene findet zwar statt, aber ihr künftiger Erfolg ist gefährdet. Die Gründe sind die zu geringe Produktivitätssteigerung der Neat sowie die 2024 auslaufenden Betriebsbeiträge für den kombinierten Verkehr.

Die Zahl der Lastwagenbewegungen durch die Schweizer Alpen sinkt: Im letzten Jahr waren es noch 941’000 Fahrten, während die Bahn ihren Marktanteil auf 70,5 Prozent erhöhen konnte. So zu lesen im Verlagerungsbericht 2018 vom Bundesamt für Verkehr (BAV).
Im Geschäftsjahr 2018 konnte die Hupac-Gruppe ihren Umsatz um 19,4 Prozent auf 579,7 Mio. Franken steigern. Mit dafür verantwortlich war der transalpine Verkehr durch die Schweiz: Hupac Intermodal AG brachte 67’000 Strassensendungen zusätzlich auf die Schiene (+14,4 Prozent). Klammert man die Rückgewinnung der Volumenverluste durch die siebenwöchige Sperrung der Rheintalstrecke bei Rastatt aus, konnten die Verkehrsmengen um etwa acht Prozent gesteigert werden. Wachstumsträger war erneut das Segment der Sattelauflieger (+45 Prozent). Auf der Lötschberg-Simplon-Achse, die den Transport von Sattelaufliegern mit Viermeterprofil ermöglicht, konnte das Volumen sogar verdoppelt werden. Mit der Eröffnung des Viermeterkorridors via Gotthard- und Ceneri-Basistunnel und der Anbindung des Terminals Busto Arsizio-Gallarate per Ende 2020 wird Hupac einen weiteren grösseren Beitrag zur Verkehrsverlagerung leisten können.
Limit erreicht?
Zwei Jahre nach Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels ist allerdings erkennbar, dass die seinerzeit avisierten Produktivitätsverbesserungen für den kombinierten Verkehr nur zum Teil erzielt werden können. Zwar werden durch den Wegfall der Doppeltraktion auf den Bergstrecken die Bahnkosten reduziert, und dank längerer Züge können per 2021 mehr Ladeeinheiten pro Zug befördert werden. Gegenüber den heutigen Betriebsbeiträgen, die per 2024 auslaufen, verbleibe laut Hupac jedoch eine erhebliche Lücke, die den kombinierten Verkehr gegenüber der Strasse verteuert und somit die Verkehrsverlagerung gefährde. Faktoren, welche die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Korridor Rhein–Alpen schmälern, sind u.a.:
- Die Anschlussstrecken in Deutschland sind auf eine Zuglänge von 690 statt 740 Meter beschränkt. Mit einem vollständigen Ausbau ist frühestens 2030 zu rechnen.
- Auf einigen Strecken bestehen weiterhin Steigungen, die eine Doppeltraktion erfordern. Als Zeithorizont für den Ausbau der Strecke Lugano–Chiasso wird 2050 genannt.
- In Italien muss die Möglichkeit des Verkehrs von Zügen von über 1600 t geprüft werden, da die elektrischen Unterstationen derzeit keine höheren Zuggewichte erlauben.
- Durch nicht synchronisierte Fahrpläne zwischen der Schweiz und den Nachbarländern wird der Zeit- und folglich Produktivitätsgewinn des Gotthard-Basistunnels an den Grenzen zunichte gemacht.
Verlagerung nicht ohne weitere Betriebsbeiträge?
Seit Jahren bereitet sich Hupac auf die vom Parlament beschlossene Abschaffung der Betriebsbeiträge für den kombinierten Verkehr per Ende 2023 vor, rechnet aber damit, dass per 2024 nur die Hälfte der heutigen Betriebsbeiträge – rund 110 Mio. Franken für den gesamten transalpinen kombinierten Verkehr – kompensiert werden kann. Auch die vom Bundesamt für Verkehr vorgesehene Senkung der Trassenpreise ab 2021 reduziert die Belastung des Güterverkehrs; sie reiche jedoch bei Weitem nicht aus.
«Um die positive Dynamik der Verkehrsverlagerung fortzusetzen, sollten die Betriebsbeiträge der Schweiz auf niedrigerem Niveau bis ca. 2030 zur Überbrückung der bestehenden Defizite vorgesehen werden», schlägt Hans-Jörg Bertschi, VR-Präsident der Hupac AG, vor und rechnet mit rund 100 Franken pro LKW. Erst nach dem vollständigen Ausbau des Korridors Rhein–Alpen und nach Wiederherstellung eines reibungslosen Verkehrs auf einer störungsfreien Infrastruktur könne der kombinierte Verkehr die vollen Produktivitätsvorteile der Neat nutzen und eigenwirtschaftlich bestehen.