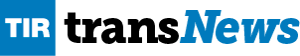Der neue VW Transporter – ein «alter» Bekannter
ERSTE FAHREINDRÜCKE Das komplett neu entwickelte Kernmodell von VW Nutzfahrzeuge kommt jetzt zu den Händlern, zunächst batterieelektrisch sowie als Verbrenner, später dann auch als eHybrid und mit VW-exklusiver Doppelkabine. Wir konnten erste Fahreindrücke sammeln.

Nach 75 Jahren baut Volkswagen Nutzfahrzeuge den Transporter zum ersten Mal nicht selbst, sondern lässt ihn bei Ford Otosan in der Türkei auf einer eigenen Montagelinie und nach eigenen Qualitätskriterien produzieren. Dies ist möglich, weil der neue VW Transporter und der Ford Transit Custom (beziehungsweise Caravelle und Tourneo Custom) als Kooperationsfahrzeuge entwickelt wurden und unter dem Blech und der Cockpitabdeckung in fast allem identisch sind. Das hat beim Duo Ford Ranger und VW Amarok sowie Ford Tourneo Connect und VW Caddy schon bestens funktioniert und findet, wie der erste Augenschein zeigt, mit dem Transporter eine zufriedenstellende Fortsetzung.
Der neue Transporter ist äusserlich eindeutig als Volkswagen zu erkennen. Sein aus dem Multivan weiterentwickeltes Gesicht ist modern, oder eher noch postmodern. Die digitale Cockpit-Landschaft aus den digitalen 12-Zoll-Instrumenten («Digital Cockpit» mit 30 cm Durchmesser) und dem 13-Zoll-Touchscreen kennen wir bereits aus dem Ford Transit Custom, doch die VW-Designer haben mit dem Interface, den Abdeckungen und Funktionselementen (wie Lenkrad) im markenspezifischen Auftritt einen derart guten Job gemacht, dass die enge Verwandtschaft nur absoluten Kennern auffällt.

VW Transporter Variantenreich wie nie
Den neuen Transporter gibt es als Kastenwagen in verschiedenen Ausführungen, als Kombi für den Transport grösserer Teams plus Equipment und (ab einem späteren Zeitpunkt) als Pritschenwagen mit Doppelkabine sowie – je nach Version – mit zwei Radständen und zwei Dachhöhen. Das Schwestermodell Caravelle für den professionellen Personentransport kommt (mit zwei Radständen) als Grossraumtaxi mit acht oder neun Sitzplätzen bis hin zum exklusiven VIP-Shuttle zum Einsatz.
Nutzwerte deutlich verbessert
- In der Grundversion sind Transporter und Caravelle 5050 mm lang, also 146 mm mehr gegenüber T6.1.
- Der «kurze Radstand» vergrösserte sich um 97 mm auf 3100 mm, der optional «lange Radstand» auf 3500 mm bei 5450 mm Gesamtlänge.
- Mit 2032 mm bieten alle Modelle eine um 128 mm vergrösserte Aussenbreite, die vollständig dem Innenraum zugutekommt.
- In der Serienausführung beträgt die Höhe 1984 mm (Normaldach); beim Hochdach sind es knapp unter 2,5 m.
- Durch die neuen Dimensionen der Karosserie bieten alle Modelle ein deutliches Plus an Platz im Fahrtgast- und Laderaum:
- Die maximale Breite zwischen den Radkästen wuchs um 148 mm auf 1392 mm. Der Laderaumboden wurde 61 mm länger.
- Vom Plus an Länge und Breite profitierte auch das Ladevolumen: Beim Standardkastenwagen beträgt es jetzt bis zu 5,8 m³ (T6.1: 5,5 m³), mit langem Radstand und Hochdach sind es bis zu 9,0 m³. Maximale Nutzlast beträgt jetzt bis zu 1,33 t (+0,13 t).
- Neu können Transporter und Caravelle (je nach Variante) bis zu 2,8 t an den Haken nehmen. Beim Vorgänger waren es bis zu 2,5 t.
- Auch die Dachlast erhöhte sich von 150 auf 170 kg.

Fahreindrücke ohne «aber»
Für VW Transporter und Caravelle kommt ein komplett neues Antriebsprogramm aus aktuell acht Antriebsversionen zum Einsatz. Erstmals wird diese Baureihe dabei parallel zu den wichtigen Turbodieselmotoren (TDI) mit neu entwickelten Elektroantrieben (e-Transporter und e-Caravelle) angeboten. Später ergänzt ein neuer Plug-in-Hybridantrieb (eHybrid) mit 125 kW / 170 PS das Angebot.
Erste Fahreindrücke sammeln wir mit einem Kastenwagen mit 2.0 TDI und 8-Gang-Automatik. Eine gute Kombination, wie rasch klar wird. Der 125 kW resp. 170 PS starke Selbstzünder überzeugt durch ein durchgängig starkes Drehmoment und blitzschnelles Reaktionsvermögen. Es wird nie laut oder brummig in der Kabine des Fronttrieblers, wir spüren kein Turboloch und keine Zugkraftunterbrechung, wenn die Automatik die Gänge wechselt.

Gegenüber dem T6.1 fällt vor allem auf, dass kurze Stösse durch schlechte Fahrbahnverhältnisse nun nahezu komplett weggefiltert werden. Für den hohen Komfort und das sehr präzise Fahrverhalten ist ein Achsverbund aus vorderen MacPherson-Federbeinen samt Querstabilisator und einer platzsparend bauenden Hinterrad-Einzelaufhängung mit Längslenkern verantwortlich. Optional steht für die Transporter und Caravelle mit Frontantrieb (TDI und eHybrid) eine Vorderachsdifferenzialsperre zur Verfügung. Erwähnenswert sind auch die kleinen Wendekreise: 11,9 m mit kurzem Radstand und 13,0 m in der Langversion.
Weil Verbrenner auch die kommenden Jahre noch dominieren oder zumindest einen relevanten Anteil erreichen werden, wird der Dieselmotor in drei Leistungsstufen angeboten. Noch mehr Auswahl bieten die batterieelektrischen Antriebe von 85 bis 210 kW. Die Topversion war in unserem zweiten Testfahrzeug verbaut, einem Personentransporter Caravelle mit 210 kW / 286 PS sowie 64-kWh-netto-Batterie. Bot der Verbrenner schon Fahrfreude, so ging einem hier das Herz noch mehr auf. Ein Tick ruhiger – lautestes Geräusch waren die Abrollgeräusche der Reifen –, sowie spürbar mehr Drehmoment, das für eine präzise dosierbare und lineare Kraftentfaltung sorgte, ohne aber je brachial zu werden. Besonders beeindruckte im direkten Vergleich die Lenkung des BEV. Liess sich der Verbrenner mit Frontantrieb schon spielend leicht dirigieren, fehlen im heckgetriebenen BEV sämtliche Antriebseinflüsse auf die Lenkung. Das Nutzfahrzeug fährt sich geschmeidig wie auf Schienen. Berufs- und Langstreckenfahrer können sich auf die neue Generation freuen.